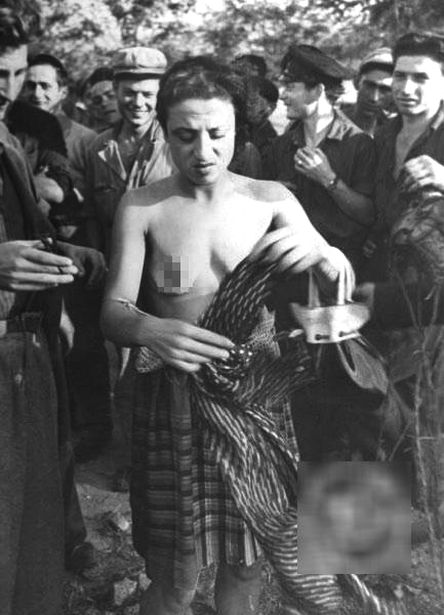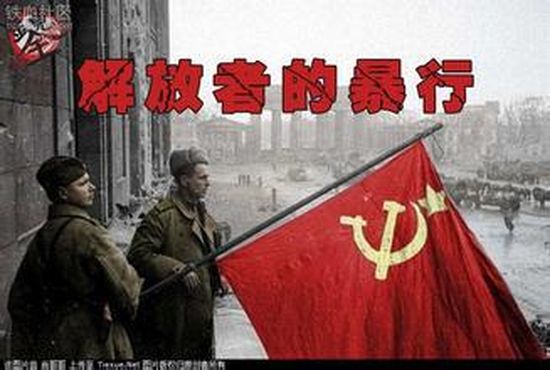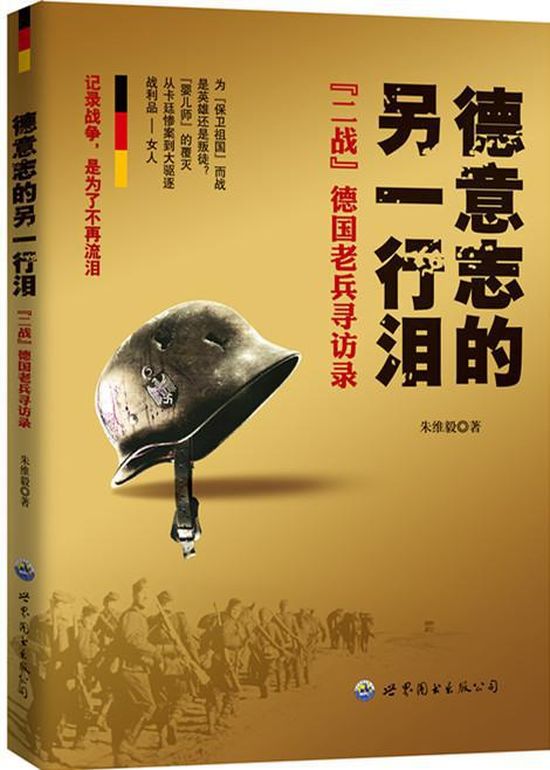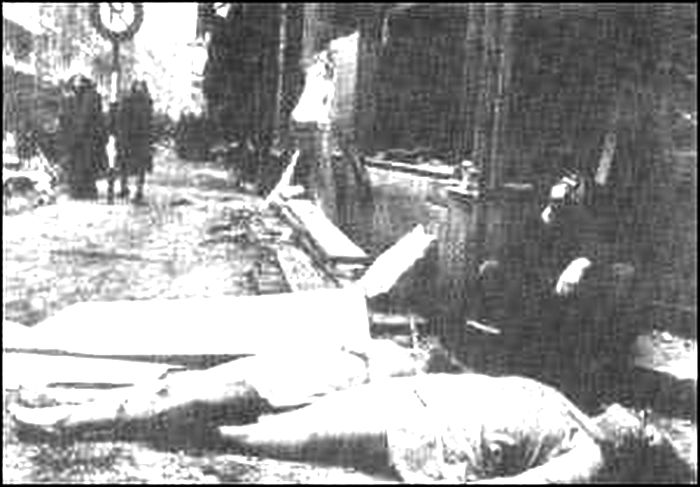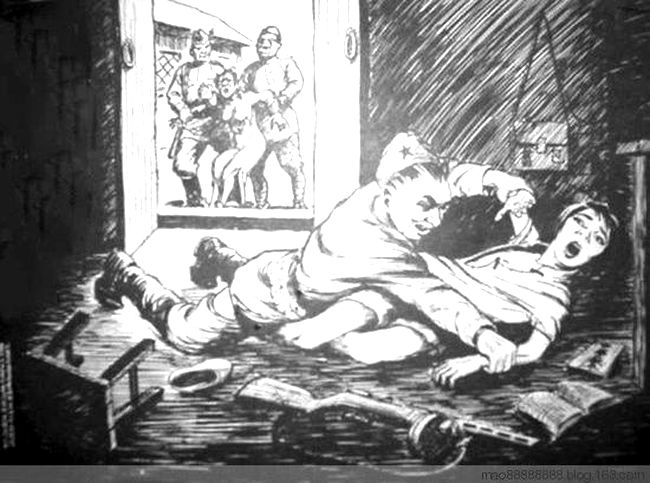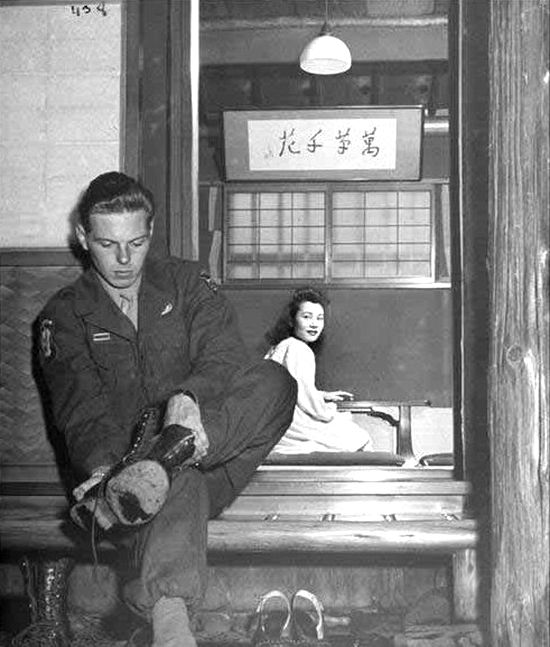Im Jahr 1945 begleitete der australische
Kriegskorrespondent Osman Marbai die Dritte Armee von General George
Patton in Europa, um Deutschland den letzten Schlag zu versetzen.
Einige Tage nach dem Ende der Schlacht um Berlin im Mai 1945 machte er
folgende Aufzeichnung.


Nachdem die sowjetische Armee Berlin erobert hatte, wurden deutsche Kriegsgefangene von den Straßen zusammengetrieben.

Am 2. Mai 1945
eroberte die sowjetische Rote Armee Berlin. Laut Untersuchungen
deutscher Historiker wurden rund 10 Millionen Berliner Frauen von
sowjetischen Soldaten vergewaltigt. Am 2. Mai strahlte die BBC den
Dokumentarfilm "Rape of Berlin" aus, der auf eine bis heute kaum thematisierte humanitäre Katastrophe aufmerksam machte.
Die Einnahme Berlins durch die Rote Armee wurde für viele Berliner Frauen zum Albtraum.
Vor 70 Jahren, nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der völligen Zerstörung
Europas, wurden die kollektiven und individuellen Verbrechen der
Achsenmächte untersucht und geahndet, um Gerechtigkeit
herzustellen und das Leid zu lindern. Doch auch die Alliierten
verursachten – absichtlich oder unabsichtlich –
großes Leid unter der Zivilbevölkerung, sei es durch die
Bombardierung Dresdens, die Brandbombenangriffe auf Tokio oder durch
Übergriffe alliierter Truppen, insbesondere der sowjetischen Roten
Armee, nach dem Einmarsch in Deutschland.
Am 2. Mai 1945
kapitulierte die Wehrmacht, und die Rote Armee eroberte Berlin. Obwohl
der Krieg formal beendet war, begann für viele Berliner
Zivilisten, insbesondere Frauen, ein neuer Albtraum.
Laut einer Studie der Universität Göttingen erreichte die
Vergewaltigungsrate unter Berliner Frauen ein Drittel. Die deutschen
Historiker Saunders und Joille kamen zu einer vorsichtigeren
Schätzung: Von zehn Millionen Berliner Frauen seien 40 % mehrfach
vergewaltigt worden. In Russland wird das Thema bis heute nur
zögerlich behandelt, viele empfinden entsprechende Berichte als
beleidigend oder ungerecht.
Am 2. Mai strahlte die BBC die Spezialdokumentation "Rape of Berlin" aus, die die lange verdrängte humanitäre Katastrophe einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machte.
Während der sowjetischen Besatzung Berlins wurde etwa ein Drittel der Berliner Frauen Opfer sexueller Gewalt.
Am Rand Berlins, im
Treptower Park, befindet sich ein sowjetisches Kriegsdenkmal, das von
sowjetischen Architekten entworfen wurde. Es erinnert an die Berliner
Schlacht und die Opfer unter den rund 80.000 sowjetischen Soldaten;
etwa 5.000 von ihnen sind auf dem Areal bestattet. Das 1949 errichtete
Denkmal gehört zu den drei großen sowjetischen Ehrenmalen in
Deutschland.

Das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin
Das Denkmal zeigt
eine monumentale Skulptur eines sowjetischen Soldaten, der ernst
blickend auf einem Sockel steht. In seiner linken Hand hält er ein
kleines deutsches Mädchen, in seiner rechten ein Schwert. Sein
Fuß ruht auf einem zerbrochenen Hakenkreuz der NSDAP. Die
Skulptur ist zwölf Meter hoch.
Der Legende nach soll ein sowjetischer Soldat während des Krieges
ein etwa dreijähriges deutsches Mädchen unter feindlichem
Kugelhagel gerettet haben – daran soll dieses Denkmal erinnern.
Auf den Inschriften wird betont, dass die Sowjetunion Europa von der
faschistischen Bedrohung befreit habe.
Allerdings wird auch berichtet, dass unter dem Denkmal unbekannte Täter von Vergewaltigungen begraben seien.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs trugen sowjetische Truppen
maßgeblich zur Zerschlagung des Dritten Reiches bei, doch auf
ihrem Marsch wurden viele Frauen Opfer sexueller Gewalt.
Viele Zeitzeugen
berichteten: Zwischen dem 24. April 1945 (Einmarsch der Roten Armee in
Berlin) und dem 5. Mai 1945 (Ende der letzten deutschen
Widerstände) wurden etwa ein Drittel der Berliner Frauen
vergewaltigt.
Die Historiker Saunders und Joille kamen nach umfangreichen
Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass rund 10 Millionen Berliner Frauen
betroffen waren, von denen 40 % mehrfach vergewaltigt wurden.
Laut dem amerikanischen Historiker William Hitchcock wurden manche Frauen bis zu 60- oder 70-mal vergewaltigt.
Krankenhausberichte und die steigende Zahl an Abtreibungen in den
Monaten nach Kriegsende deuten darauf hin, dass nahezu eine Million
Frauen an den Folgen der Vergewaltigungen starben.
In Russland wird
das Thema oft als beleidigend empfunden und von offiziellen Medien
weitgehend ignoriert. Dabei ist unbestreitbar, dass sowjetische
Soldaten nicht die einzigen Täter von sexueller Gewalt im Krieg
waren – und dass die Vergewaltigungen in Berlin im Kontext der
Schrecken des Zweiten Weltkrieges gesehen werden müssen.
Die Nazi-Invasion der Sowjetunion, die Hitler selbst als
"Vernichtungskrieg" bezeichnete, hatte dort unsägliches Leid
angerichtet.
Ein jüdischer Leutnant der Roten Armee, Wladimir Gelfand,
dokumentierte in seinem Tagebuch offen die Realität und das Leid
der deutschen Frauen – ein einzigartiges Zeugnis über eine
oft verdrängte Wahrheit.

Ukrainischer Leutnant Wladimir Gelfand
Obwohl die Geschichte
der Vergewaltigungen durch die Sowjetarmee selten thematisiert wird,
existieren dennoch einige wichtige Quellen, die helfen, die Ereignisse
jener Zeit zu rekonstruieren. Zwei Tagebücher, die im
Frühjahr 1945 verfasst wurden, bieten einen Einblick in das
damalige Geschehen.
Das erste Tagebuch stammt von Wladimir Gelfand,
einem jüdischen Leutnant aus der Ukraine. Nach Gelfands Tod
entdeckte sein Sohn Vitali das Tagebuch beim Durchsehen seiner Papiere.
Als die Rote Armee in
die "Höhle des faschistischen Tieres" vordrang, ließ ein
sowjetischer Propagandaoffizier ein Banner aufhängen, um die Moral
der Soldaten zu stärken:
"Soldaten: Ihr seid nun im Land Deutschland – es ist Zeit, Rache zu nehmen!"
In Gelfands
Aufzeichnungen finden sich erschütternde Berichte über
deutsche Frauen, die aus den Vororten Berlins flohen.
"Sie waren voller Angst", schrieb er. "Sie erzählten mir, dass die Rote Armee bereits in der ersten Nacht angekommen war."
Ein deutsches Mädchen sagte: "Mehr als 20 Männer haben mich vergewaltigt." Und sie brach in Tränen aus. "Plötzlich bat mich das Mädchen, bei ihr zu bleiben: 'Du kannst mit mir machen, was du willst, aber nur du.'"
Das Tagebuch „Eine Frau in Berlin“
Gelfand schilderte
das psychische Trauma der Mädchen und ihre verzweifelten Versuche,
sich vor weiteren Übergriffen zu schützen.
Ähnliche Erlebnisse schildert ein weiteres berühmtes Tagebuch: "Eine Frau in Berlin",
geschrieben von einer damals 30-jährigen deutschen Journalistin,
deren Identität lange unbekannt blieb. Ihr Bericht wurde
später zum Bestseller.
Das Tagebuch
beginnt am 20. April 1945, zehn Tage vor Hitlers Selbstmord, und wurde
größtenteils in einem Keller unter Artilleriebeschuss
verfasst.
Während sie und ihre Nachbarn sich in einem Keller versteckten, scherzten sie, dass es "besser sei, von russischen Jungs niedergetrampelt zu werden, als von amerikanischen Bomben getötet zu werden."
Doch als sowjetische Soldaten schließlich den Keller betraten,
halfen ihr ihre Russischkenntnisse wenig – wenige Minuten
später wurde sie brutal vergewaltigt.
Später
beschloss sie, sich gezielt einem hochrangigen sowjetischen Offizier
aus Leningrad anzuschließen, mit dem sie Gespräche über
Literatur und das Leben führte.
"Ich kann nicht sagen, dass mich der Offizier vergewaltigte", schrieb sie. "Habe
ich es für Speck, Butter, Zucker, Kerzen oder Konserven getan? Ich
liebe ihn nicht als Mann, aber je weniger er von mir verlangt, desto
mehr respektiere ich seine Persönlichkeit."
Als ihr Tagebuch
1959 erstmals veröffentlicht wurde, warf ihr die deutsche
Gesellschaft vor, den Ruf deutscher Frauen beschmutzt zu haben.
Neues Interesse an den Verbrechen der Alliierten
In jüngster
Zeit nimmt die Folklore- und Geschichtsforschung die Vergewaltigungen
durch alliierte Soldaten (Amerikaner, Briten, Franzosen und
insbesondere Sowjets) zunehmend in den Blick. Doch bleibt dieses
Kapitel nach wie vor ein Randthema im öffentlichen Diskurs –
viele wollen nicht darüber sprechen oder zuhören.
Vor allem in der
DDR war es tabu, die "Heldentaten" der sowjetischen Soldaten zu
kritisieren. Auch im Westen war die Beschäftigung mit diesen
Verbrechen durch die Schuldfrage an den NS-Verbrechen lange blockiert.
Mutige Stimmen und der Film "Eine Frau in Berlin"
Der 2008 erschienene Film "Anonyma – Eine Frau in Berlin", basierend auf dem gleichnamigen Tagebuch, hatte eine große Wirkung in Deutschland.
Viele Frauen, darunter auch Ingeborg Bullert, wagten es nach Jahrzehnten erstmals, über ihr erlittenes Schicksal zu sprechen.

Die 90-jährige Ingeborg erzählt erstmals von ihrer Vergewaltigung 1945 in Berlin
Die 90-jährige Ingeborg
lebt heute in Hamburg. Als die sowjetische Armee in Berlin
Gräueltaten verübte, versteckte sie sich – wie viele
andere – in einem Keller.
Doch als sie hinaufstieg, um ein Seil für einen Lampendocht zu
holen, wurde sie von zwei sowjetischen Soldaten mit vorgehaltener Waffe
bedroht und anschließend vergewaltigt.
Ingeborg berichtet,
dass die Zahl der in Berlin vergewaltigten Frauen unermesslich sei.
Alle Frauen zwischen 15 und 55 Jahren wurden dazu verpflichtet, sich
auf sexuell übertragbare Krankheiten untersuchen zu lassen.
"Man brauchte ein Heft, um einen Stempel zu bekommen. Ich erinnere mich, dass das Wartezimmer voller Frauen war", sagt sie.
Das volle Ausmaß dieser sexuellen Gewalt wird vermutlich nie vollständig bekannt sein.
Sowjetische Militärarchive und andere Quellen bleiben bis heute
unter Verschluss. Zudem verabschiedete die russische Staatsduma
kürzlich ein Gesetz, das vorsieht, dass "jeder,
der Russland im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg diskreditiert,
mit Geldstrafen oder bis zu fünf Jahren Haft bestraft wird."
Vitalij Gelfand, der Sohn von Oberleutnant Wladimir Gelfand, erklärte:
Er wolle nicht bestreiten, dass viele sowjetische Soldaten während
des Zweiten Weltkriegs großen Mut und Opferbereitschaft gezeigt
hätten. Dennoch hoffe er, dass das Tagebuch seines Vaters endlich
vollständig veröffentlicht werde, um eine umfassendere
Wahrheit ans Licht zu bringen.
"Wenn die Menschen die Wahrheit nicht erfahren wollen, dann betrügen sie sich selbst", sagte er. "Die
ganze Welt versteht es – auch Russland sollte verstehen –,
dass nur der Blick in die Vergangenheit die Zukunft möglich macht."
Quellen:
-
„Suche nach deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg“, Zhu Weiyi, Verlag Tongxin, 2005.
-
„The
Struggle for Europe: The Turbulent History of a Divided Continent, 1945
to the Present“, William Hitchcock, 2004 (keine chinesische
Übersetzung).
-
„Die Schlacht um Berlin im Zweiten Weltkrieg“, Tilman Remme, ausgestrahlt auf dem BBC History Channel.
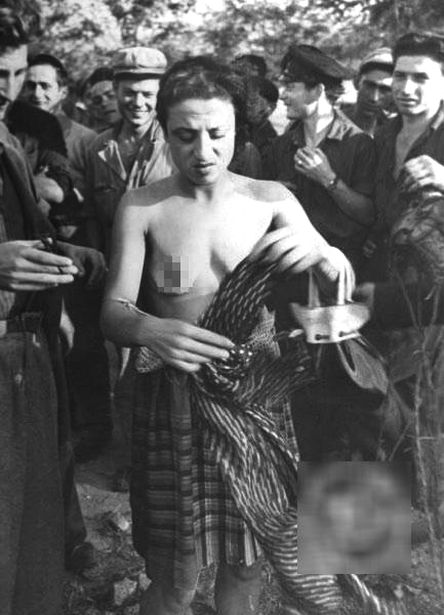
Da die Täter zu
der siegreichen Partei gehörten, die ursprünglich als Opfer
von Aggression dargestellt wurde und der Feind der zivilisierten Welt
war, blieb dieses entsetzliche kollektive Verbrechen ungesühnt. Es
fand weder echte internationale Beachtung noch ernsthafte Verurteilung.
Die Welle der Vergewaltigungen während dieser Zeit bleibt eine
unauslöschliche Erinnerung für die deutschen Frauen, die
damals Opfer wurden. Für sie ist es offensichtlich bis heute
schwer zu glauben, dass Gerechtigkeit in der Welt tatsächlich
existiert.
Ich habe versucht,
einige ältere deutsche Damen nach ihren Erlebnissen zu befragen.
Obwohl ich meine Fragen äußerst taktvoll formulierte, war
niemand bereit, auf meine Anfrage zu antworten.
In diesem Verhalten erkannte ich ein tiefes, schmerzvolles Bedürfnis nach Verständnis.
Damals verloren diese Frauen nicht nur ihre körperliche
Unversehrtheit, sondern auch einen Teil ihrer Lebenswürde. Der
einzige verbleibende "Wert" war, durch die Mündung eines Gewehrs
gezwungen zu werden, den Willen der Sieger zu ertragen.
Wie könnte jemand freiwillig die eigenen seelischen Narben wieder aufreißen, um über so etwas zu sprechen?
Deshalb bleibt es meist still.
Ich sah keine
andere Möglichkeit, als historische Zeugnisse und erhaltene Texte
zu suchen, um eine Geschichte zu rekonstruieren, die für die
chinesische Öffentlichkeit nahezu unbekannt ist.
In diesem Prozess fand ich einen besonders bewegenden Bericht eines
Vergewaltigungsopfers, das selbst den Mut fand, seine Erlebnisse
niederzuschreiben.

Der Name der alten
Dame war Hildgart Kristof. Nach ihrem Tod im Jahr 1997
veröffentlichte ihre Tochter eine Sammlung mündlicher
Erzählungen ihrer Mutter unter dem Titel "Jeder Tag ist Krieg".
Die alte Frau lebte vor dem Krieg in der westpreußischen Stadt
Sonnenfeld (heute Tesinka, Polen). Nach Kriegsende wurde sie vertrieben
und ließ sich in Bayern nieder.
Hier eine Zusammenfassung ihrer Erinnerungen:
Der Winter 1944 war
hart und ungewöhnlich kalt. Die Ostfront rückte Tag für
Tag näher. Unsere Männer – Väter, Brüder,
Söhne – waren alle an der Front. Niemand von uns konnte sich
vorstellen, welches Schicksal uns im Januar 1945 erwartete.
Am 27. Januar, dem Geburtstag des ehemaligen deutschen Kaisers Wilhelm
II., fuhren sowjetische Panzer in unsere Stadt Sonnenfeld ein.
Die russischen Soldaten trugen dicke, lange Uniformmäntel und
schwere Stiefel. Sie stürmten in die Häuser, raubten Schmuck
und Uhren. Jeder Widerstand war zwecklos. Bei Widerstand wurde sofort
geschossen.
In der ersten Nacht
versteckten sich mehrere Nachbarn, darunter wir, im obersten Stockwerk
der Lehmann-Brauerei. Meine Cousine aus Berlin, die vor den
Bombenangriffen zu uns geflüchtet war, lebte bei mir und hatte ein
zweijähriges Kind bei sich. Sie besaß eine Pistole, aber mit
nur wenigen Patronen – nicht genug für einen gemeinsamen
Suizid.
Die ganze Nacht über hörten wir aus unserem Versteck das
Donnern der Waffen. Erst im Morgengrauen wagten wir es, zurück in
unsere Wohnungen zu schleichen.
Russische Soldaten suchten überall nach jungen Frauen. Wurden sie
entdeckt, schleppten sie die Frauen in leere Häuser und
vergewaltigten sie kollektiv.
Damals war ich 24 Jahre alt und lebte Tag für Tag in Angst.
Während der
ersten sechs Wochen der Besatzung durften wir das Stadtgebiet nicht
verlassen. Eines Nachts brachen russische Soldaten in unser Haus ein
und entführten meine Cousine.
Weil das Verschließen der Türen verboten war, hatten sie leichtes Spiel.
Unter Waffengewalt zwangen sie uns alle in einen Raum, wo schon andere
junge Frauen zusammengetrieben worden waren. Es begann eine Nacht
voller Gruppenvergewaltigungen, die bis zum Morgengrauen andauerte.
Als wir völlig entkräftet nach Hause zurückkehrten, war
unsere Mutter glücklich, dass wir überhaupt noch lebten.
Damals wurden viele Frauen nach der Vergewaltigung getötet.
Zahlreiche Menschen begingen Selbstmord – wir mussten oft Seile durchschneiden und die Leichen beerdigen.
Obwohl 60 % der
Stadt in Trümmern lagen, arbeiteten einige Bäckereien weiter.
Die Russen zwangen Frauen, Brot zu backen. Für diese Arbeit
bekamen wir täglich 200 Gramm Brot.
Einmal schleppten uns Soldaten in ein leerstehendes Haus, um
Hühner zu rupfen. Doch nach der Arbeit gab es nicht nur kein Essen
– wir wurden erneut vergewaltigt.
Später
schickte man uns auf einen Bauernhof außerhalb der Stadt. Wir
mussten Vieh füttern, Milch, Butter und Lebensmittel für die
Russen bereitstellen.
Wenn sie kamen, um Nahrung zu holen, zogen sie mich oft in ein leeres Gebäude.
Meine Mutter versuchte verzweifelt, sie davon abzuhalten, indem sie ihnen erklärte, ich sei schwanger...
Dr. Arnold
Nidenchu, der während des Krieges als Arzt in einem Krankenhaus in
Rauschen (heute Rewal, Polen) tätig war, schilderte in seinen
Memoiren die Ereignisse aus ärztlicher Perspektive:
Als die Russen Ostpreußen einnahmen, blieb ich als behandelnder Arzt im Josephs-Krankenhaus in Rauschen.
Am 8. Januar 1945, nach kurzem Widerstand, fiel die Stadt an die
Sowjets. Es folgten groß angelegte Plünderungen,
Brandstiftungen, Vergewaltigungen und Morde durch die Besatzer.
Am ersten Tag
wurden 60 Einwohner getötet – die meisten waren Frauen, die
vergewaltigt wurden, Männer, die Frauen und Kinder schützen
wollten, und Menschen, die ihre Uhren oder Alkohol nicht freiwillig
herausgaben.
Eines Tages wurde
in mein Krankenhaus eine schwer verletzte schwangere Frau eingeliefert:
Sie hatte eine Schusswunde an der Lunge erlitten.
Sie berichtete, ein sowjetischer Soldat habe sie trotz ihrer
Schwangerschaft brutal getreten und in den Bauch geschossen, nachdem
sie ihn um Schonung gebeten hatte.

Bald wurde die
Vergewaltigung zu einer völlig außer Kontrolle geratenen
Welle. Nach meinen Beobachtungen im Krankenhaus schätze ich, dass
nur etwa 10 % der Frauen im Alter zwischen 15 und 50 Jahren der
Vergewaltigung entkommen konnten. Die sowjetischen Soldaten machten bei
ihren Gewalttaten kaum Unterschiede: Vergewaltigt wurden
Achtzigjährige ebenso wie Zehnjährige, Schwangere und
Mütter.
Abends drangen
sowjetische Soldaten durch Türen, Fenster oder Dächer in die
Häuser der Zivilbevölkerung ein, manchmal sogar mitten am
Tag. Oft hielten sie den Frauen Pistolen in den Mund, um sie zur
Unterwerfung zu zwingen. Häufig hielten mehrere Männer eine
Frau fest, um sie dann abwechselnd zu vergewaltigen. Manchmal endete
das Martyrium mit der Ermordung der Opfer. Ich kenne zwei Frauen, die
auf diese Weise getötet wurden. Oft vergewaltigten die Soldaten
die Opfer auch direkt auf der Straße.
Ich glaube, dass
nur sehr wenige Russen sich nicht an diesen Gräueltaten
beteiligten. In dieser Hinsicht gab es kaum Unterschiede zwischen
Offizieren und einfachen Soldaten. Einmal wurde ein zehnjähriges
Mädchen, das schwer verletzt war, nach einer Vergewaltigung ins
Krankenhaus eingeliefert. Ich konnte meine Empörung nicht
zurückhalten und bat über einen polnischen Übersetzer
darum, beim sowjetischen Oberkommando vorzusprechen, ob es eine
Möglichkeit gebe, solche Verbrechen zu stoppen. Die Antwort
lautete: „Es war sehr schwierig, so etwas von Anfang an zu
verbieten.“ Einige Täter wurden zeitweise verhaftet, aber
meist nach wenigen Stunden wieder freigelassen.
Die Zahl der
sexuell übertragbaren Krankheiten stieg rapide, besonders unter
den jungen Opfern. Medikamente waren knapp, Apotheken waren
geplündert worden. Im Krankenhaus mussten wir täglich mehr
als 25 neue Fälle behandeln. Viele Mädchen versuchten, sich
durch feste Beziehungen zu einzelnen Tätern zu schützen.
Als die sowjetische
und deutsche Frontlinie weiter nach Westen vorrückte, begannen
deutsche Zivilisten, für die Leiden der Sowjetunion zu
„bezahlen“. Mit Billigung des Militärs ergoss sich der
angestaute Hass der sowjetischen Soldaten hemmungslos über die
deutschen Frauen.
Im Zuge der
Eroberung Nazi-Deutschlands sprachen sowjetische Propagandisten oft von
„Befreiung“. Doch für das deutsche Volk, insbesondere
für unzählige Frauen, bedeutete die Ankunft der Roten Armee
den Beginn unvorstellbaren Leids. Männer wurden verschleppt,
Frauen vergewaltigt — eine nationale Katastrophe ohne Beispiel.
Zur
Vergewaltigungsgeschichte deutscher Frauen durch sowjetische Soldaten
existiert bislang die gründlichste Untersuchung durch zwei
deutsche feministische Intellektuelle: die Schriftstellerin und
Filmproduzentin Sander sowie die Autorin Dr. Jorge. Beide hatten als
Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt und forschten fünf Jahre lang
zu diesem Thema. Viele Opfer weigerten sich, an der Untersuchung
teilzunehmen; von den wenigen, die bereit waren, zu sprechen, wollten
die meisten anonym bleiben und nicht vor der Kamera erscheinen.
Sander und Jorge
führten nicht nur zahlreiche Interviews mit überlebenden
Frauen, sondern fanden auch Wege, mit ehemaligen sowjetischen Soldaten
zu sprechen. Zudem durchforsteten sie Tagebücher, Memoiren,
Literatur und Krankenhausakten.
Auf Grundlage ihrer
Recherchen kamen sie zu folgenden erschütternden Zahlen:
Während der sowjetischen Invasion Berlins wurden etwa 1,9
Millionen Frauen von sowjetischen Soldaten vergewaltigt. Davon waren
1,4 Millionen Übergriffe auf dem Vormarsch Richtung Westen
erfolgt, während weitere 500.000 Vergewaltigungen während der
sowjetischen Besatzungszeit stattfanden. Insgesamt wurden in Berlin
etwa 10 Millionen Frauen vergewaltigt, wobei 40 % der Opfer mehrmals
missbraucht wurden. Fast zehntausend Frauen starben infolge der
erlittenen Gewalt.

Die Zahl der
deutschen Frauen, die von sowjetischen Soldaten vergewaltigt wurden,
wird auf etwa zwei Millionen geschätzt. Diese Zahl wird sowohl
durch historische Statistiken des Bundesarchivs als auch des Berliner
Stadtarchivs bestätigt. Auch der amerikanische Historiker
Professor Norman M. Naimark kam in seinem Buch Die Russen in Deutschland
zu derselben Schlussfolgerung. Für die Gesamtzahl der deutschen
Frauen, die in den deutschen Siedlungsgebieten im Sudetenland, in
Österreich und in Südosteuropa Opfer von Vergewaltigungen
wurden, liegen jedoch keine zuverlässigen statistischen Angaben
vor.
Sander und Jorge
stellten fest, dass der Großteil der Vergewaltigungen im Raum
Berlin zwischen dem 27. April und dem 4. Mai 1945 stattfand. Mit
anderen Worten: In den letzten Tagen der Schlacht um Berlin und in den
ersten Tagen nach ihrem Ende herrschte in der ganzen Stadt ein Ausbruch
von sexueller Gewalt.
Das deutsche Magazin Stern
schrieb in einem Rückblick auf diese Ereignisse, dass Soldaten
sich manchmal regelrecht aufstellten, um Frauen zu vergewaltigen, wobei
die Abläufe oft organisiert waren. Dennoch kam es auch zu
chaotischen Szenen, bei denen Soldaten sich gegenseitig die Gürtel
herunterrissen, um schneller an die Opfer zu gelangen. Viele Frauen
wurden dabei getötet. In Berlin verbreitete sich Panik: Eltern
versuchten, ihre Töchter auf Dachböden oder in Trümmern
zu verstecken; einige kleideten ihre Töchter als alte Frauen, um
sie zu tarnen. Doch dieser Trick war zu bekannt und wurde von
sowjetischen Soldaten meist schnell durchschaut. Nur wenigen gelang es,
dem Schrecken zu entkommen.
Ein bemerkenswertes
Phänomen ist, dass nach dem Krieg vor allem weibliche Gelehrte die
umfassendste Aufarbeitung dieser Verbrechen vornahmen. Der Grund
dafür dürfte nicht nur in der Geschlechtergemeinschaft
zwischen Opfern und Forscherinnen liegen, was die Öffnung dieses
schmerzhaften Themas erleichterte, sondern auch im tieferen
Verständnis der Betroffenheit und im stärkeren Willen, das
Böse zu bekämpfen.
Der Schriftsteller Friedrich beschreibt in seinem Buch Die Berliner Arena,
wie ein 18-jähriges Mädchen mehr als sechzig Mal von
sowjetischen Soldaten vergewaltigt wurde. Die Soldaten gaben die
Adresse der Frau weiter, sodass immer neue Täter kamen. Sogar der
Vater des Mädchens wurde gezwungen, die Misshandlungen
mitanzusehen. Schließlich schnitt er sich die Pulsadern auf,
nachdem seine Tochter dutzende Male missbraucht worden war. Er sagte:
„Mit der verlorenen Würde ist alles verloren.“
Viele der
vergewaltigten Frauen mussten nicht nur die Zerstörung ihrer
körperlichen und seelischen Integrität erleiden, sondern
wurden später auch von ihren Mitbürgern verachtet. Oft galten
sie als „Hausflurbeute“, wurden von ihren
Familienangehörigen verleugnet oder verstoßen. Viele
wählten aus Verzweiflung den Tod durch Erhängen oder
Selbstmord. Viele wurden auch infolge der Vergewaltigungen schwanger.
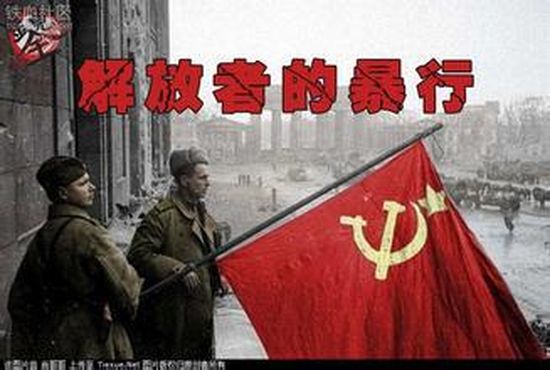
Das Unglaublichste ist, dass die Sowjets auch gegenüber ihren eigenen Landsfrauen keinerlei Barmherzigkeit zeigten.
Als die Deutschen den
westlichen Teil der Sowjetunion besetzten, wurden viele sowjetische
Zivilisten nach Deutschland zur Zwangsarbeit verschleppt. Als diese
Arbeiter aus Russland, der Ukraine und Belarus später von den
Sowjets "befreit" wurden, wurden viele von ihnen von ihren eigenen
Landsleuten vergewaltigt.
Im August 1945
verfasste Gaikow, stellvertretender Direktor der Politischen Abteilung
der 1. Ukrainischen Armee, einen Bericht über solche
Vorfälle. Nach dem Zerfall der Sowjetunion fand der britische
Historiker Bayer in den geöffneten russischen Archiven den
Originalbericht und veröffentlichte Teile daraus:
-
In der Nacht des
14. Februar wurde ein Dorf von sowjetischen Truppen umstellt; sie
brachen in die Häuser ein und vergewaltigten die gerade befreiten
Frauen.
-
In der Nacht des
24. Februar kamen 35 Offiziere und Soldaten nach Gren Tengberg, etwa
zehn Kilometer östlich von Els, drangen in die Wohnungen ein und
vergewaltigten die Frauen.
-
Im
Hauptquartier von Boinzlau (heute Bolesławiec, Polen) wohnten über
hundert befreite Frauen in einem Haus in der Nähe. Am Abend des 5.
März brachen sechs Soldaten der 3. Gardepanzerarmee in das
Gebäude ein, schlugen und vergewaltigten zahlreiche Frauen.
Solche
Übergriffe geschahen fast jede Nacht. Die Frauen waren
verängstigt, verzweifelt und zutiefst enttäuscht. Eine von
ihnen, Maria Schapwal, sagte:
„Ich habe den ganzen
Tag auf die Rote Armee gewartet, auf die Befreiung, aber jetzt
behandeln uns unsere eigenen Soldaten schlimmer als die
Deutschen.“
Eine andere Frau berichtete:
„Mein Vater und zwei
Brüder dienten in der Roten Armee. Als die Deutschen unsere Stadt
besetzten, wurde ich zur Arbeit in eine deutsche Fabrik verschleppt.
Als die Rote Armee eintraf, hoffte ich auf Rettung – doch die
Soldaten missbrauchten mich. Ich sagte einem Offizier, dass auch mein
Bruder in der Roten Armee diente, doch er schlug mich nur und
vergewaltigte mich.“
Der Bericht wurde
schnell an das Zentralkomitee des Komsomol weitergeleitet und am 29.
des Monats dem sowjetischen Verteidigungskommissar Malenkow
übergeben.
Bemerkenswert ist,
dass Gaikows Absicht bei der Einreichung des Berichts nicht darin lag,
die Vergewaltigungen zu stoppen. Stattdessen schlug er vor, die
"politisch-ideologische Arbeit" unter den Heimkehrern zu intensivieren,
damit sie ihre Unzufriedenheit nicht in der Heimat verbreiteten.
Es ist anzunehmen,
dass Gaikows "abmildernder" Vorschlag eine Strategie war: Da die
Verbrechen stillschweigend von oben gebilligt wurden, konnte er die
Vergehen nur auf eine Weise ansprechen, die die
Militärführung akzeptieren würde. Sein Bericht
änderte die Praxis nicht – doch er hinterließ ein
wichtiges historisches Zeugnis.
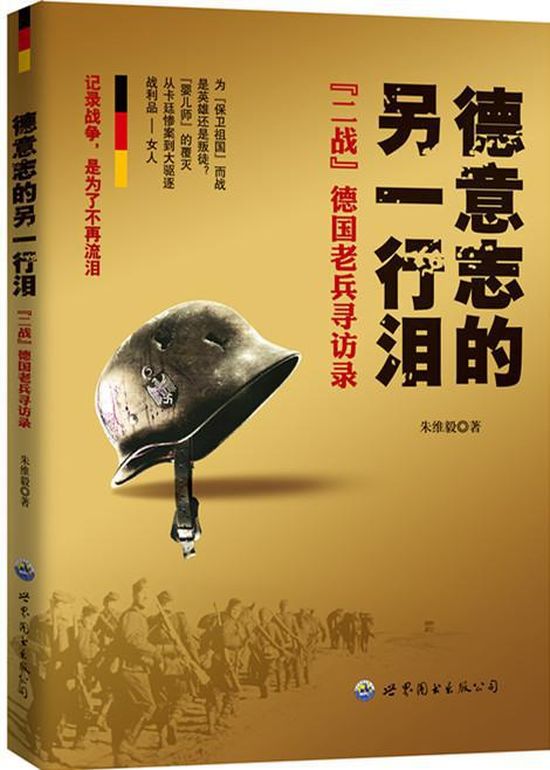
Die schmerzhaften
Lektionen des Zweiten Weltkriegs zwangen Europa, den historischen
Kreislauf von „Krieg – Fehde – neuer Krieg“ zu
durchbrechen. Doch das bedeutet nicht, dass die Menschen den Schmerz
der Geschichte einfach vergessen könnten.
Hannelore Kohl, die
Ehefrau des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl, wurde am
Ende des Krieges von sowjetischen Soldaten vergewaltigt – damals
war sie erst zwanzig Jahre alt.
Ein Freund aus der Berliner Staatsbibliothek sagte dazu:
„Es war nicht die
Schande von Frau Kohl, auch nicht die Demütigung Deutschlands,
sondern die Schande der Sowjetunion, die nie darüber reflektiert
hat – und letztlich unter ihrer eigenen Schuld
zusammenbrach.“
Vergewaltigungen
durch siegreiche Armeen haben besonders schwerwiegende Folgen, denn
solche Gräueltaten lassen sich gesellschaftlich kaum
bewältigen. Gleichzeitig werfen groß angelegte
Kriegsverbrechen einen langen Schatten auf das Ansehen der betreffenden
Armee und des dahinterstehenden Staates.
Die
Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten verstärkten den Hass
Europas auf die Sowjetunion und behinderten die Verbreitung
sowjetischer Ideale nach dem Krieg erheblich.
Deutsche Frauen zahlten den höchsten Preis für die Verbrechen
des Nazi-Regimes, doch die Vergewaltigungen durch die Sowjets
verdunkelten auch den Ruhm ihres militärischen Sieges.
Letzten Endes
zerstört eine Armee, die solche Gräueltaten begeht, nicht nur
die Würde der Opfer, sondern auch ihre eigene.
Denn eine Armee verteidigt nicht nur das Territorium ihres Vaterlandes – sie steht auch für dessen Ehre.
Wenn eine Armee Frauen schändet, zertritt sie zugleich ihre eigene
Ehre und prägt ihrem Land eine hässliche Narbe ein, die nur
schwer jemals verheilt.
Die Geschichte
zeigt: Wo immer eine Armee kollektive Vergewaltigungen beging, wird der
Nachruhm – selbst bei militärischer Größe –
getrübt.
So ruft etwa die Erwähnung des Begriffs „Japanisch“
bis heute vielerorts sofort negative Assoziationen hervor – eine
Folge der Kriegsverbrechen in Ostasien.
Deutschland, Stadt Metgethen: Frauen und Kinder von der Roten Armee getötet – Spuren von Vergewaltigungen
Krieg – ob
„gerecht“ oder nicht – ist grausam und
rücksichtslos. Diese Grausamkeit zeigt sich nicht nur auf dem
Schlachtfeld, sondern oft auch in den Katastrophen, die die
Zivilbevölkerung treffen.
Unabhängig davon, wer den Krieg begonnen hat oder wie sehr die
Befehlshaber auf militärische Disziplin pochen: Plünderung,
Misshandlung und Vergewaltigung von Zivilisten lassen sich im Krieg
kaum vollständig verhindern.
Der Militärhistoriker Antony Beevor veröffentlichte das Buch „Berlin: Der Untergang 1945“,
basierend auf bisher unveröffentlichten russischen Archiven,
Kriegsmaterialien aus Deutschland, den USA, Frankreich und Schweden
sowie den Berichten und Aufzeichnungen von Opfern.
Er stellte darin fest, dass die sowjetische Rote Armee auf ihrem Weg
von Ostpreußen nach Berlin innerhalb von fast drei Jahren
schätzungsweise zwei Millionen Frauen vergewaltigte – manche
von ihnen sogar mehrfach.
Allein in Berlin wurden etwa 130.000 Frauen Opfer von sexueller Gewalt,
rund 10.000 davon begingen anschließend Selbstmord.
Das Buch „Berlin: Der Untergang 1945“
wurde im Vereinigten Königreich veröffentlicht. Der russische
Botschafter in Großbritannien bezeichnete es als
„Beleidigung“.
Doch viele Überlebende berichteten, dass ihnen die Lektüre
des Buches alte, jahrelang verdrängte Schmerzen wieder ins
Bewusstsein rief – und dass endlich über ein lange
tabuisiertes Kapitel gesprochen wurde.
Die
Veröffentlichung über die Vergewaltigungen deutscher Frauen
durch die Rote Armee brach das jahrzehntelange Schweigen der Opfer.
Zu ihnen gehörte auch die spätere Ehefrau des ehemaligen
deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl: Als sie zwölf Jahre alt war,
wurde sie gemeinsam mit ihrer Mutter vergewaltigt.

Als
die Vergewaltigung durch die Rote Armee geschah, war Marta bereits
über achtzig Jahre alt. Dennoch konnte sie die Jahre des Schmerzes
nicht unterdrücken:
„Sie (die Rote Armee) fanden mich, befahlen mir, die Leichen des
toten Hitlerjugend-Korps zu begraben. Dann zwangen sie mich auf den
Friedhof und vergewaltigten mich, einer nach dem anderen“,
erzählte sie wieder und wieder.
„Ich lüge nicht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Sie müssen mir glauben.“
„Eine Frau in Berlin“: Die Reporterin wurde selbst vergewaltigt
2003 veröffentlichte die deutsche Journalistin Marta Hillers ihr Tagebuch „Eine Frau in Berlin“, das sie im Jahr 1945 im zerstörten Berlin geführt hatte. Ihre persönlichen Erlebnisse bestätigten:
Nach dem Zusammenbruch Deutschlands 1945 vergewaltigte die sowjetische Rote Armee zahllose hilflose deutsche Frauen.
Ein Opfer berichtete, dass ein Soldat der Roten Armee versuchte, ihre Mutter zu vergewaltigen.
Sie selbst entriss dem Soldaten die Waffe und versuchte, ihn zu
erwürgen. Doch sie schaffte es nicht. Stattdessen wurde sie selbst
von weiteren sowjetischen Soldaten vergewaltigt. Dieses Trauma
begleitet sie bis heute.
Im Jahr 1945 war Marta Hillers dreißig Jahre alt und unverheiratet. Sie lebte in Ost-Berlin.
Nach dem Fall Berlins versteckte sie sich aus Angst in einem Keller.
Am 27. April 1945 entdeckten sowjetische Soldaten ihr Versteck. Sie zogen sie in den Flur und vergewaltigten sie brutal.
In den folgenden Tagen versuchte Hillers, ihr eigenes Überleben zu sichern:
Sie nutzte ihre fließenden Russischkenntnisse und bot sich einem
älteren sowjetischen Offizier als „Schutzfrau“ an, um
sich vor weiteren Übergriffen zu schützen.
In ihrem Tagebuch schrieb sie später:
„Ich habe alles getan, um zu überleben.“
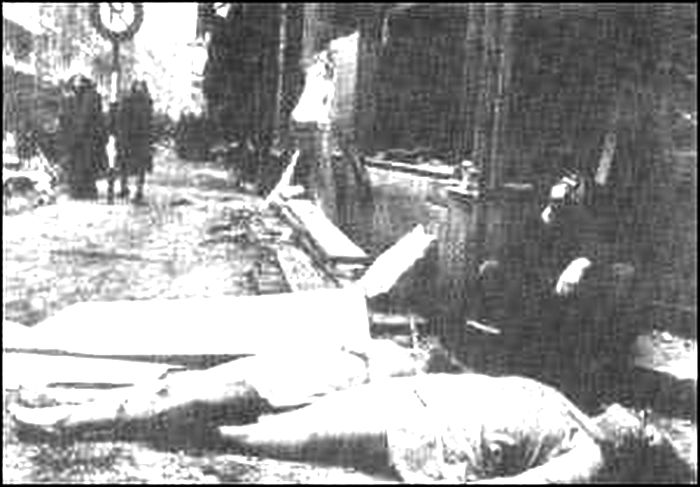
Das Verhalten der sowjetischen Roten Armee in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs
1990 sorgten die bekannten Feministinnen Helke Sander und Barbara Johr mit ihrem Film „Befreier und Befreite – Krieg, Vergewaltigung, Kinder“
für großes Aufsehen und eine heftige öffentliche
Diskussion. Viele Frauen, die durch den Krieg traumatisiert worden
waren, traten an sie heran, um von ihren Erfahrungen über die
Vergewaltigungen durch Soldaten der sowjetischen Roten Armee zu
berichten.
„Im
Jahr 1945, als 450.000 Soldaten der Roten Armee Berlin angriffen,
lebten dort etwa 1,4 Millionen Mädchen und Frauen. Im
Frühsommer 1945 waren 110.000 von ihnen von Soldaten der Roten
Armee vergewaltigt worden – das entsprach 7,4 % der Gesamtzahl.
Unter den Opfern waren zahlreiche Mädchen und Frauen im
gebärfähigen Alter, darunter 11.000 Schwangere.“
Die Zahl der vergewaltigten Mädchen und Frauen entspricht dabei
nicht der Zahl der Vergewaltigungen insgesamt, da etwa 40 % der Opfer
mehrmals vergewaltigt wurden.
Viele Frauen erinnern sich noch an die Schrecken jener Zeit:
Wenn Soldaten kamen, plünderten und brandschatzten sie nicht nur, sondern schrien auch laut: „Frau, komm!“
Sie drangen in die Häuser ein, sammelten deutsche Frauen –
vom jungen Mädchen bis zur Frau mittleren Alters – und
verübten kollektive Vergewaltigungen.
Für viele Frauen waren die Gräueltaten unerträglich:
Manche starben an den Folgen, andere begingen Selbstmord, um der
Schande zu entkommen.
Einige Historiker
schätzen, dass zwischen dem 24. April und dem 5. Mai 1945 fast
eine halbe Million Frauen allein in Berlin von sowjetischen Soldaten
vergewaltigt wurden – das entspricht etwa 30 % aller Frauen in
der Stadt.
Insgesamt wird
davon ausgegangen, dass im Zweiten Weltkrieg über 2 Millionen
deutsche Frauen durch Soldaten der sowjetischen Roten Armee
vergewaltigt wurden.
Erschreckend ist, dass nur ein verschwindend kleiner Teil der Täter zur Rechenschaft gezogen wurde:
Die überwältigende Mehrheit der Vergewaltiger wurde nie
bestraft, viele erhielten sogar Medaillen und kehrten ohne jedes
Schuldbewusstsein oder Reue in ihre Heimat zurück.

Deutscher Zeitzeuge: Russische Soldaten vergewaltigten Frauen kollektiv
Nach Zhu Weiyis Buch „Auf der Suche nach den deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs“ hier eine Zusammenfassung der Erinnerungen eines alten Mannes:
„1944
waren unsere Männer, Väter, Brüder und Söhne alle
an der Front. In der ersten Nacht nach dem Einmarsch der sowjetischen
Truppen verbrachten wir eine schlaflose Nacht auf dem Dachboden und
hörten, wie die Stadt von Schüssen erfüllt war. Erst mit
der Morgendämmerung wagten wir es, in unsere Häuser
zurückzukehren. Überall suchten russische Soldaten nach
jungen Frauen, packten sie und verschleppten sie in leere Häuser,
wo sie dann kollektiv vergewaltigt wurden. Ich war damals 24 Jahre alt
und lebte jeden Tag in Angst.
Eines
Nachts brachen sowjetische Soldaten in unser Haus ein und schleppten
meine Cousine fort. Sie zwangen uns mit vorgehaltener Waffe in einen
Raum, in dem bereits einige junge Frauen versammelt waren. Dann begann
eine Nacht voller Gruppenvergewaltigungen. Die Männer
stürzten sich abwechselnd auf uns, bis die ersten Sonnenstrahlen
kamen. Als wir unsere schwachen Körper nach Hause schleppten, war
unsere Mutter nur froh, uns lebend wiederzusehen.
Viele Frauen wurden damals vergewaltigt und anschließend
getötet. In unserer Stadt gab es viele Selbstmorde – oft
mussten wir die Seile durchschneiden und die Opfer begraben.*
Dr. Arnold Nidenchu, der während des Krieges in einem Krankenhaus in Rossel (heute Polen) arbeitete, erlebte die Gewalt als behandelnder Arzt:
„Als
die Russen Ostpreußen einnahmen, blieb ich als Arzt im
Josephs-Krankenhaus. Am 8. Januar 1945 wurde Rossel nach nur geringem
Widerstand von den Sowjets besetzt. Danach begannen umfassende
Gräueltaten – Plünderungen, Brandstiftung,
Massenvergewaltigungen und Morde. Bereits am ersten Tag wurden sechzig
Einwohner getötet, meist Frauen, die sich gegen Vergewaltigung
wehrten, sowie Männer, die versuchten, Frauen und Kinder zu
schützen.“
Die Vergewaltigungen nahmen schnell ein erschreckendes Ausmaß an.
Unter den Frauen zwischen 15 und 50 Jahren entkamen nach Einschätzung von Nidenchu nur etwa 10 % der sexuellen Gewalt.
Die Soldaten kannten kaum Grenzen: selbst 80-jährige Frauen,
10-jährige Mädchen, Schwangere und Mütter wurden Opfer.
Abends
drangen russische Soldaten durch Türen, Fenster oder Dächer
in die Häuser der Zivilbevölkerung ein und suchten nach
Frauen – oft sogar tagsüber.
Meist hielten mehrere Männer eine Frau fest, während sie sie
nacheinander vergewaltigten. Am Ende wurden einige der Opfer
erschossen, um keine Zeugen zu hinterlassen. Zwei Frauen, die Dr.
Nidenchu persönlich kannte, wurden auf diese Weise ermordet.
Er berichtete auch von „Seitenvergewaltigungen“, bei denen Frauen während der Gewaltakte getötet wurden.
„Ich
glaube, nur wenige Russen waren nicht an diesen Verbrechen beteiligt.
Offiziere und Soldaten machten kaum einen Unterschied.“
Die
Situation verschlimmerte sich weiter durch die rapide Verbreitung von
Geschlechtskrankheiten, insbesondere unter den jungen Opfern.
Medikamente waren knapp, Apotheken geplündert, und das Krankenhaus
musste täglich mehr als 25 neue Fälle von sexuell
übertragbaren Krankheiten behandeln.
Viele Mädchen versuchten schließlich, durch eine Art
„Schutzbeziehung“ zu einem sowjetischen Soldaten wenigstens
wiederkehrenden Übergriffen zu entgehen.
Während
die sowjetische Armee das Wort „Befreiung“ für ihre
Eroberung Nazi-Deutschlands benutzte, war es für viele Deutsche
schwierig, diese sogenannte „Befreiung“ anzuerkennen.
Vor allem für unzählige deutsche Frauen bedeutete die Ankunft
der Roten Armee eine Katastrophe – keine Befreiung.

Die Sowjets hatten drei Hauptfaktoren, die zu ihren sexuellen Verbrechen beitrugen:
Erstens war die
sowjetische Rote Armee weltweit die Armee mit dem höchsten Risiko
und der höchsten Sterblichkeitsrate. Diese extremen Bedingungen
waren wohl der Hauptgrund für die sexuellen Übergriffe
sowjetischer Soldaten. Nach dem ostpreußischen Feldzug 1945
verbreitete das deutsche Goebbels-Propagandaministerium Filmaufnahmen
von 64 Vergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen durch
sowjetische Soldaten.
Untersuchungen
europäischer Organisationen ergaben, dass nach dem Sieg in der
Berliner Schlacht Plünderungen und Vergewaltigungen an der
Tagesordnung waren. Die sowjetischen Soldaten raubten bevorzugt
deutsche Uhren. Das berühmte Foto von drei Rotarmisten, die auf
dem Reichstagsgebäude die rote Fahne hissen, zeigt bei genauerem
Hinsehen, dass ein sowjetischer Soldat zwei Uhren trägt. Insgesamt
wurden während der sowjetischen Besatzung Deutschlands etwa zwei
Millionen deutsche Frauen vergewaltigt. Bereits Ende 1944 wurden
innerhalb einer einzigen sowjetischen Panzerarmee über 1000
Vergewaltigungsfälle registriert.
Zweitens war das
Bildungsniveau vieler sowjetischer Soldaten sehr niedrig. Viele von
ihnen waren einfache Bauern oder Hirten. Die sowjetische Regierung
legte großen Wert auf militärischen Patriotismus und auf die
Erziehung zum Hass gegen den Nationalsozialismus, vernachlässigte
jedoch die moralische Schulung ihrer Soldaten. Dies trug erheblich zu
den sexuellen Verbrechen bei.
In der deutschen
Wehrmacht hingegen waren solche kollektiven Verbrechen kaum
möglich. Einerseits betrieben die Deutschen offizielle
"Troststationen", andererseits verhinderte die NS-Ideologie der
"rassischen Reinheit" sexuelle Kontakte zu osteuropäischen Frauen.
Zudem wurden Sexualverbrechen in der Wehrmacht streng bestraft, was zu
deutlich weniger Übergriffen führte.
In der sowjetischen
Armee hingegen wurden sexuelle Übergriffe weder streng verfolgt
noch verhindert. Vielmehr wurde das Verhalten der Soldaten oft geduldet
oder gar gefördert. Die Übergriffe waren häufig
organisierte kollektive Handlungen. Mit Maschinenpistolen drangen
Soldaten in deutsche Häuser ein und vergewaltigten Frauen unter
Waffengewalt.
Drittens spielte
der Alkoholmissbrauch unter sowjetischen Soldaten eine große
Rolle. Fast alle Soldaten tranken exzessiv, was die Gewaltakte
zusätzlich anheizte. Man kann sich vorstellen, was in deutschen
Haushalten nachts nach dem Einmarsch der Roten Armee geschah.
Die Lage der
Zivilbevölkerung in Berlin verschlechterte sich dramatisch. Am 28.
April beobachtete eine Frau, die anonym blieb, von ihrem Fenster aus
die Szene auf der Straße. "Ich habe ein seltsames Gefühl im
Bauch", schrieb sie in ihr Tagebuch. "Es erinnert mich an die Angst vor
einem Mathetest in der Schule." Draußen versorgten sowjetische
Soldaten ihre Pferde; überall lag der Geruch von Pferdemist. In
einer nahegelegenen Garage hatten die Soldaten eine Feldkantine
eingerichtet, deutsche Zivilisten wagten sich kaum noch auf die
Straßen. Einige Sowjets fanden Fahrräder und versuchten,
damit zu fahren. Der Anblick bedrückte die Frau – sie
erschienen ihr wie große Kinder.

Als sie es wagte, hinauszugehen, fragte sie jemand als Erstes: „Hast du einen Mann?“
Sie sprach ein wenig Russisch, wodurch sie zunächst
„peinliche Missverständnisse“ vermeiden konnte. Doch
als sie merkte, dass die Soldaten ihr zuzwinkerten, bekam sie Angst.
Ein Soldat, der stark nach Alkohol roch, kam in den Keller, torkelte
auf sie zu, leuchtete ihr mit der Taschenlampe ins Gesicht und machte
keinen Hehl aus seinen Absichten. Die Frau tat so, als wolle sie ihn
nach oben führen, und nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Sie
rannte auf die hell erleuchteten Straßen. Andere Soldaten kamen
in den Keller, stahlen zivile Uhren, begingen aber zunächst keine
weiteren Gewalttaten.
Doch am Abend, als
die Disziplin nachließ, begannen sie nach Beute zu suchen. Drei
sowjetische Soldaten überfielen sie im Dunkeln und fingen an, sie
zu vergewaltigen. Als der zweite Soldat sie misshandelte, erschienen
drei weitere sowjetische Soldaten, darunter eine weibliche Soldatin.
Als sie die Szene sahen, lachten alle, einschließlich der Frau.
Als sie
schließlich wieder ins Zimmer zurückkehrte, verbarrikadierte
sie die Tür mit Möbeln und legte sich erschöpft ins
Bett. Fast alle Frauen in Berlin erlebten in jener Zeit ähnliche
Verstümmelungen. Sie stellte fest, dass es kein fließendes
Wasser gab, um sich zu waschen, was die Situation noch
unerträglicher machte. Kaum hatte sie sich hingelegt, wurde die
Barrikade an der Tür weggeschoben. Eine Gruppe Soldaten brach ein
und begann, in ihrer Küche zu trinken. Als sie versuchte, sich
davon zu schleichen, wurde sie von einem großen Mann namens Peter
Card gepackt. Sie bat ihn, andere davon abzuhalten, sie zu
vergewaltigen. Er stimmte zu. Am nächsten Morgen verabschiedete er
sich freundlich, drückte ihre Hand fast zu fest und versprach, um
sieben Uhr zurückzukehren.
Viele andere Frauen
versuchten ebenfalls, sich an einen Soldaten zu „binden“,
in der Hoffnung, dadurch vor Gruppenvergewaltigungen geschützt zu
sein. Maggie Weilan, eine 24-jährige Schauspielerin, versteckte
sich, als die sowjetischen Soldaten in die Giselastraße kamen,
nicht weit von der Kurfürstenstraße entfernt. Sie nannte
dies „den schrecklichsten Moment des gesamten Krieges“.
Als die Soldaten hereinkamen, kauerte sie sich in einen kunstvoll
geschnitzten Pfirsichholzschrank. Ein junger Soldat aus Zentralasien
zog sie heraus; als er das blonde junge Mädchen sah, war er so
aufgeregt, dass er vorzeitig ejakulierte. Maggie deutete ihm an, dass
sie seine Freundin sein würde, wenn er sie vor anderen
beschützen würde. Begeistert lief er zu seinen Kameraden, um
anzugeben. Doch ein anderer Soldat kam und vergewaltigte sie brutal.
Margarets
jüdische Freundin Ellen Gates entkam ebenfalls aus der
Wrightstraße und versteckte sich während eines sowjetischen
Bombardements in einem Keller. Auch sie wurde von sowjetischen Soldaten
vergewaltigt. Als die Deutschen versuchten, den Russen zu
erklären, dass sie Jüdin sei und verfolgt worden war,
antworteten die Russen nur kalt: „Deutsche sind Deutsche.“
Russische Offiziere erschienen später. Obwohl ihr Verhalten
korrekt war, unternahmen sie keine Maßnahmen, um ihre Soldaten zu
stoppen.
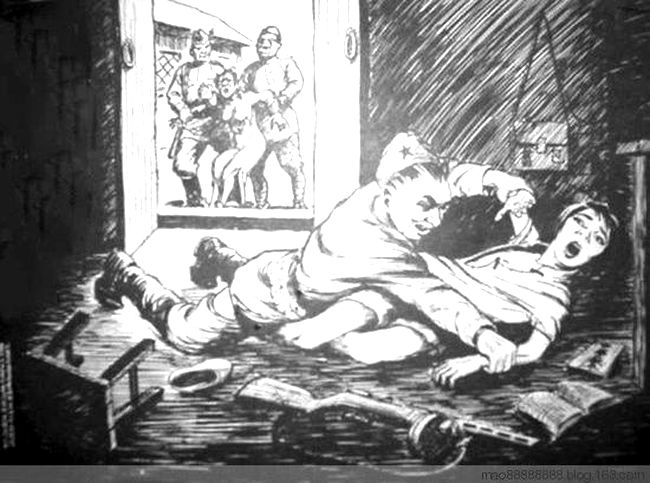
Die
Gisela-Brecht-Straße beherbergt Bewohner aus allen Schichten des
Berliner Lebens. In Halle 10 wohnte der bekannte Journalist Hans
Gonzeche, der im bombardierten Keller für den Besitz
jüdischen Eigentums verurteilt worden war. Im dritten Stock
residierte noch immer die Geliebte von Carleton Brenner. Die Tür
zu seinem Zimmer war vergoldet, das Zimmer selbst mit Seidenmöbeln
und Wandteppichen geschmückt – zweifellos Beutegut aus den
von Deutschland besetzten Gebieten Europas. Im benachbarten Haus Nr. 11
befand sich der berüchtigte "Kitty-Salon" – ein Bordell
unter Aufsicht der Nazis. Dort arbeiteten sechzehn junge Prostituierte,
die zu Beginn des Krieges von Heinrich und Schleinberg rekrutiert
worden waren. Die SS-Geheimdiensteinheit war für den Betrieb und
die Überwachung zuständig, kontrollierte hochrangige Beamte,
Offiziere der Wehrmacht und ausländische Diplomaten. Nach der
Eroberung Berlins waren es die sowjetischen „Angriots“, die
großes Interesse daran hatten, die deutsche Abhörtechnik zu
untersuchen.
Im angrenzenden
Nebengebäude wohnte Admiral Paul von Hase, Kommandant der Berliner
Stadtverteidigung, der später im Zusammenhang mit dem
Attentatsversuch vom 20. Juli verhaftet und hingerichtet wurde.
Als die
Hitlerjugend und die SS-Wachtruppen auf Häuser feuerten, die
weiße Fahnen zeigten, fanden sich Berliner Zivilisten zwischen
die rücksichtslosen Angriffe beider Kriegsparteien. In den Ruinen
verbreiteten verwesende Leichen einen üblen Gestank, einige
zerstörte Gebäude waren von dem Geruch verbrannten Fleisches
durchzogen. Doch diese Schrecken beeindruckten die Soldaten der Roten
Armee kaum. In ihren Augen war Berlin die „graue, erschreckende
und düstere Stadt des Untergangs“, die „Hauptstadt von
Banditen“, geformt durch drei Jahre sowjetischer Propaganda.
Auch deutsche
Kommunisten blieben vom Schicksal nicht verschont. Der Stadtteil
Wedding war bis 1933 eine Hochburg der deutschen Linken. Als die Rote
Armee den Bezirk besetzte, begrüßten Aktivisten auf der
Müllerstraße die sowjetischen Kommandeure,
präsentierten Mitgliedsausweise, die sie während der
zwölf Jahre der Illegalität als Kommunisten getragen hatten,
und boten an, deren Uniformen zu waschen. Dennoch, so berichtete ein
französischer Kriegsgefangener, wurden die Frauen dieser
Aktivisten noch in derselben Nacht von sowjetischen Offizieren
vergewaltigt.
Während sich
die sowjetischen Panzer T-34 und Stalins in Richtung Potsdamer Platz
und Wilhelmstraße bewegten, richtete sich die Aufmerksamkeit der
Roten Armee zunehmend auf den Norden Berlins. Die 3. Stoßarmee
stieß quer durch den Nordosten der Stadt, bereit, den Reichstag
zu erobern.
Die 150.
Schützendivision unter General Schaworow wurde beauftragt, das
Moabit-Gefängnis zu nehmen, das angeblich unter direkter Kontrolle
von Goebbels selbst stand. Schaworow berichtete von den düsteren
Gestalten, die aus den schmalen Fenstern des Gefängnisses
starrten: „Sie blickten uns an wie wilde Tiere.“
(Überraschenderweise hatten sowjetische Soldaten bereits beim
Überschreiten der deutschen Grenze von den Bäumen aus Berlin
in der Ferne sehen können – ein Bild, das ihre
Eindrücke tief prägte.)
Die Erstürmung
des Moabit-Gefängnisses war jedoch alles andere als einfach. Trotz
schwerem Artilleriebeschuss hielt die deutsche Verteidigung fanatisch
stand. Erst nachdem die erste und zweite Sturmwelle hohe Verluste
erlitten hatten, gelang es, die Mauern des Gefängnisses zu
sprengen und den Durchbruch zu erzwingen.

Die sowjetischen
Truppen überquerten schnell die Straße und drangen in den
Hof ein. Sobald sie das Gefängnis stürmten, ergab sich die
deutsche Garnison sofort. Die Sowjets entdeckten Minen am Eingang und
begannen sofort mit der Entschärfung. Ihre Kommandeure erinnerten
sich an das schwere metallische Echo, das die eisernen Treppen im
Obergeschoss entlanghallte. Jeder bewaffnete Deutsche wurde genau
überprüft, selbst solche in minderwertigen Uniformen –
die Sowjets fürchteten insbesondere eine mögliche Falle von
Goebbels. Die Gefangenen wurden hinausgetrieben, die politischen
Häftlinge befreit. Der grelle Sonnenschein blendete sie, und sie
verengten ihre Augen.
Die sowjetische
Armee strömte überall auf die vom Rauch erfüllten
Straßen Berlins. In dieser Umgebung, in der sie ihre Kampfziele
verfolgten, erlitten die Sowjets schwere Verluste. „Mit jedem Schritt näher an den Sieg zahlen wir einen schrecklichen Preis“,
schrieb ein sowjetischer Redakteur während der Berliner Schlacht
– wenige Sekunden bevor er selbst im Feuergefecht fiel. Der Tod
war allgegenwärtig, während der brutale Krieg zu Ende ging.
Michail Schimonin, ein junger Leutnant, der von seinen Männern
geliebt wurde, inspirierte mit seinem Mut viele. „Mit mir!“
rief er seinen Männern zu, ehe er als Erster auf ein Gebäude
zustürmte. Drei Kugeln trafen ihn, bevor eine schwere
Artilleriegranate eine Hauswand in seiner Nähe zum Einsturz
brachte und ihn unter den Trümmern begrub.
Auf Berlins
Straßen und in den Häusern waren Minen verlegt, Barrikaden
errichtet, und die massiven Steinbauten dienten als Bunker. Die
sowjetische Rote Armee erkannte die Lage schnell und setzte
verstärkt 152-mm- und 203-mm-Haubitzen ein, um Durchbrüche zu
erzwingen. Besondere Vorsicht galt den zahlreichen U-Bahn-Tunneln und
Luftschutzbunkern Berlins – mehr als 1000 dieser Anlagen gab es
in der Stadt. Zivile Schutzräume wurden systematisch gesichert:
Jeder Schrei aus einem Bunker konnte tödlich enden. Gerüchte,
dass Panzer wie der T-34 in die U-Bahn-Schächte vordrangen, sind
größtenteils Legenden, mit wenigen belegten Ausnahmen. Eine
bekannte Anekdote erzählt von einem T-34, der versehentlich eine
Treppe zur Alexanderplatz-Station hinunterfuhr.
Entlang der
Moabit-Gefängnisse und der Moerzeke-Brücke, etwa 800 Meter
vom Reichstag entfernt, drangen die Truppen vor. Als sich der Rauch
verzog, zeichnete sich die Silhouette des Reichstagsgebäudes am
Horizont ab. Die 150. und 171. Infanteriedivisionen waren zwar nahe
dran, doch sie wussten, dass der letzte Sturm große Opfer kosten
würde. Um Stalin zu gefallen, sollten sie den Reichstag bis zum 1.
Mai erobern, damit die Nachricht rechtzeitig zur Maifeier in Moskau
verkündet werden konnte.
Am 28. April
begannen die sowjetischen Angriffe auf die Moerzeke-Brücke. Beide
Divisionen gingen vom gleichen Punkt aus vor – was ihre
Rivalität noch verstärkte. Die Brücke war durch ein
Minenfeld und Stacheldraht gesichert, flankiert von Maschinengewehr-
und Artilleriefeuer. Kurz nach 18:00 Uhr versuchten die Deutschen, die
Brücke zu sprengen, aber die Zerstörung war
unvollständig: Die Infanterie konnte sie noch überqueren.
Oberst Nieustrojew
befahl dem Feldwebel Pjatnizki, mit seiner Kompanie einen vorsichtigen
Angriff durchzuführen. Pjatnizki und seine Männer
überquerten unter Feuer das offene Gelände und verschanzten
sich hinter deutschen Hindernissen. Nieustrojew forderte dann
Artillerieunterstützung an. Der Feuerleitoffizier benötigte
einige Zeit, um das Sperrfeuer zu koordinieren. Als die Nacht
hereinbrach, begann das sowjetische Artilleriefeuer: Die deutschen
Stellungen wurden zerstört. Das erste Bataillon überquerte
die Brücke und stieß bis zur Kronprinzenstraße und zur
Moerzekestraße vor.
Noch während
Hitler und Eva Braun in ihrem Bunker heirateten, hatten die
sowjetischen Truppen einen stabilen Brückenkopf errichtet. Vor der
Morgendämmerung war es den meisten Einheiten der 150. und 171.
Infanteriedivision gelungen, die Spree erfolgreich zu überqueren.

Die 150.
Infanteriedivision begann im Süden der Murtkestraße mit dem
Angriff auf das deutsche Innenministerium. Die Sowjets erfuhren sofort,
dass es sich bei dem großen Gebäude um die Residenz von
Himmler handelte. Türen und Fenster waren verbarrikadiert und
wurden als Schießscharten genutzt, sodass das Gebäude zu
einer schwer einnehmbaren Festung geworden war. Da die Frontartillerie
nicht einsetzbar war, richteten sowjetische Pioniere auf einem
Bahngleisabschnitt provisorisch einen einzelnen Katyusha-Raketenwerfer
ein. Dennoch waren am 29. April die wichtigsten Kampfmittel in den
Nahkämpfen Handgranaten und Maschinenpistolen.
Trotz der Schrecken
der letzten Kriegstage hofften sowjetische Soldaten noch, ihrer Heimat
einen bleibenden Eindruck zu vermitteln. Als Eroberer Berlins sahen sie
sich als künftige Elite der Sowjetunion. Wladimir Borissowitsch
Perewjerzew schrieb am selben Tag in einem Brief: „Meine
Lieben, ich bin noch am Leben und gesund. Natürlich habe ich
einiges an Samsung-Branntwein getrunken, aber ihr müsst euch keine
Sorgen machen – das schadet dem Körper nicht allzu sehr. Wir
haben die Einkesselung des Berliner Stadtzentrums verstärkt, nur
500 Meter trennen mich vom Reichstag. Wir haben die Spree
überquert, und bald wird Deutschland fallen!“
Perewjerzew kündigte an, dass er Bilder schicken wollte, auf denen
er mit Maschinenpistole und Handgranaten zu sehen sei – doch er
starb kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.
Am 29. April, einem Sonntag, schrieb Martin Bormann in sein Tagebuch: „Dies
ist der zweite Tag des Feuers über Berlin. Nach ausländischen
Nachrichtenagenturen soll Hitler noch am Abend Eva Braun geheiratet
haben und sein politisches sowie persönliches Testament verfasst
haben. Verräter wie Jodl und Himmler haben uns verlassen und den
Bolschewiken überlassen.“ Die Lage verschlechterte sich rapide.
Hitler schwankte
zwischen Hoffnung und Verzweiflung, doch ihm wurde klar, dass alles
verloren war. Nach dem Zusammenbruch der unterirdischen
Kommunikationssysteme konnten sowjetische Abhörstationen
gewöhnliche Funksignale abfangen. Bormann und Krebs schickten an
die Kommandanten eine letzte Nachricht: „Der Führer erwartet unerschütterliche Treue und dass Berlin gerettet wird.“
Die Antworten waren ernüchternd: General Wenck erklärte, dass
seine 12. Armee schwer angeschlagen sei und keine Wende mehr bringen
könne.
Im Bunker erkannte
auch die treueste Gefolgschaft, dass Hitlers Selbstmord unausweichlich
war. Niemand wagte mehr, über Kapitulation zu sprechen. Sollte
Hitler warten, bis die Sowjets den Reichskanzlei-Bunker stürmten,
würde keiner überleben.
Friedrich von
Lorrach-Hoffen wollte diesem Schicksal entgehen. Zusammen mit anderen
verlangte er die Erlaubnis, sich der kämpfenden Truppe
anzuschließen. General Krebs und Burgdorf stimmten zu. Hitler,
müde, gab ihnen seinen Segen: „Sucht euch ein Motorboot, um leise durch die sowjetischen Linien zu kommen.“ Bald darauf schüttelte Hitler ihnen zum Abschied die Hand.
Am 29. April griff
die 301. Infanteriedivision unter Oberst Antonow die Gestapo-Zentrale
an der Prinz-Albrecht-Straße an. Nach schwerem Artilleriebeschuss
stürmten sowjetische Truppen das Gebäude und hissten die rote
Fahne – doch die SS konterte, fügte den Sowjets schwere
Verluste zu und zwang sie zum Rückzug. Nur sieben Insassen
überlebten die Massaker.
Die Division Nordland,
bestehend aus ausländischen Freiwilligen, verteidigte weiterhin
verzweifelt die Reichskanzlei. Besonders französische Freiwillige,
wie der 17-jährige Lucien aus Saint-Nazaire oder Eugène
Front-Lott, zeichneten sich im Panzerkampf aus.
Im Westen
überquerte die sowjetische 8. Gardearmee den Landwehrkanal bei
Tiergarten. Einige Soldaten schwammen über, andere benutzten
provisorische Flöße. Die Sowjets setzten Taktiken wie das
Anzünden ölgetränkter Tücher auf Panzern ein, um
die deutschen Verteidiger zu täuschen und die Potsdamer
Brücke zu überqueren.
Am Nachmittag
verhandelten sowjetische Offiziere mit deutschen Zivilisten, um den
Abzug von 1500 Menschen aus Bunkern zu ermöglichen. Doch nachdem
deutsche Offiziere versucht hatten, zu tricksen, erschoss Major Kuharew
drei von ihnen und ließ den Bunker sofort stürmen.
Zur gleichen Zeit
erreichte die sowjetische Offensive fast das Hauptquartier von General
Weidling in Bendlerblock, der eine verzweifelte Besprechung mit seinen
Kommandanten abhielt. Am nächsten Morgen sollte ein letzter
Ausbruchsversuch gestartet werden.

Berliner Filmfestival-Präsident Dieter Kosslick
Die deutsche Website des Focus-Magazins veröffentlichte am 28. Februar einen Bericht mit dem Titel „Wie alliierte Soldaten deutsche Frauen missbrauchten“.
Darin heißt es, dass viele alliierte Soldaten am Ende des Zweiten
Weltkriegs und während der Besatzungszeit deutsche Frauen
vergewaltigten. „Mindestens
860.000 deutsche Frauen und Mädchen (aber auch Männer und
Jungen) wurden von Angehörigen der alliierten Streitkräfte
vergewaltigt,“ schrieb die Historikerin Miriam Gebhardt zu Beginn ihres neuen Buches „Als die Soldaten kamen“. Ihr Buch bietet eine tiefgehende Analyse dieser Verbrechen und ihrer Auswirkungen bis heute.
Nach der Niederlage
Deutschlands fürchteten sich vor allem die Menschen im Osten vor
der Rache der Sowjets – eine Angst, die auch von der
NS-Propaganda systematisch geschürt worden war. Die Nazis warnten
die Deutschen eindringlich vor den „bestialischen“ sowjetischen Soldaten. Tatsächlich waren Vergewaltigungen und Tötungen weit verbreitet.
Gebhardt dokumentiert in ihrem Buch diese Gräueltaten aus der Perspektive der Opfer. „Ich habe anderthalb Jahre an der Recherche gearbeitet,“ sagte sie. „Ich
wollte die Gefühle und Erfahrungen der Betroffenen in den
Mittelpunkt stellen, nicht bloß eine Liste von Gräueltaten
liefern.“
Die Historikerin
räumt auch mit gängigen Vorurteilen auf. Zum einen
unterscheiden sich ihre Zahlen von bisherigen Schätzungen:
Während andere Historiker von Millionen vergewaltigter Frauen
allein in Ostdeutschland ausgehen, schätzt Gebhardt die Zahl der
Opfer auf etwa 860.000. Zum anderen zeigt sie, dass sexuelle Gewalt
nicht nur im Osten durch sowjetische Soldaten verübt wurde,
sondern auch in den britischen, französischen und amerikanischen
Besatzungszonen – teils über mehrere Tage hinweg.
Dass lange Zeit
zwischen den Taten der Alliierten und denen der Sowjets unterschieden
wurde, liegt daran, dass westliche Soldaten über Lebensmittel,
Zigaretten und Nylonstrümpfe verfügten – Dinge, die das
deutsche Volk damals verzweifelt benötigte. Dadurch entstand der
Eindruck, es habe keine Vergewaltigungen gegeben, sondern nur „Prostitution aus Not“. Dieses Bild der sogenannten „freundlichen Besatzung“ aber verkennt das Leid der Opfer.
„Bemerkenswert ist, dass nur wenige Frauen damals von Vergewaltigungen durch westliche Soldaten sprachen,“
sagte Gebhardt. Das lag auch daran, dass die westlichen Soldaten in der
NS-Propaganda nicht als „Bestien“ dargestellt worden waren.
Zudem waren die deutschen Behörden nach dem Krieg bestrebt,
gegenüber den westlichen Alliierten gefällig zu bleiben und
unterbanden Klagen über Gewalt.
Opfer von sexueller Gewalt wurden oft selbst stigmatisiert. Sie wurden als „Schlampen“ beschimpft, viele kamen in Pflegeheime. „Nach dem Krieg litten diese Frauen unter tiefem Misstrauen der Gesellschaft und einem erneuten Trauma,“ schreibt Gebhardt. „Viele von ihnen fanden nie wieder ins Leben zurück.“
Sie mussten den
doppelten Schmerz ertragen – körperliche und seelische
Verwundung –, wurden sozial geächtet und häufig in
Armut getrieben. In Fragen von Abtreibung oder Entschädigung
entschieden Ärzte und Richter meist gegen sie. Opfer mussten
beweisen, dass sie nicht freiwillig sexuelle Beziehungen zu alliierten Soldaten hatten – eine fast unmögliche Aufgabe.
Kinder, die aus diesen Beziehungen hervorgingen, galten in der Gesellschaft als „Besatzungskinder“
und wurden noch stärker diskriminiert als andere uneheliche
Kinder. Diese Kinder hatten oft keinen Anspruch auf Unterstützung
und kannten in vielen Fällen ihren Vater nicht.
Einige
Besatzungsmächte, etwa Frankreich, erklärten sich erst dann
bereit, die Verantwortung für diese Kinder zu übernehmen,
wenn die Mütter auf alle Rechte verzichteten. Doch selbst dann
wurden diese Kinder nicht etwa zu ihren Vätern geschickt, sondern
zur Adoption freigegeben. Erst 1956 erließ die Bundesrepublik
Deutschland Regelungen zur finanziellen Unterstützung dieser
Kinder. Vergewaltigungsopfer selbst erhielten jedoch keine
Entschädigung.

Nachdem das US-Militär in Japan stationiert war, mussten die
verschiedenen gesellschaftlichen Schichten Japans lernen, das
amerikanische Militär als eine Art Ruhm oder Statussymbol
wahrzunehmen.






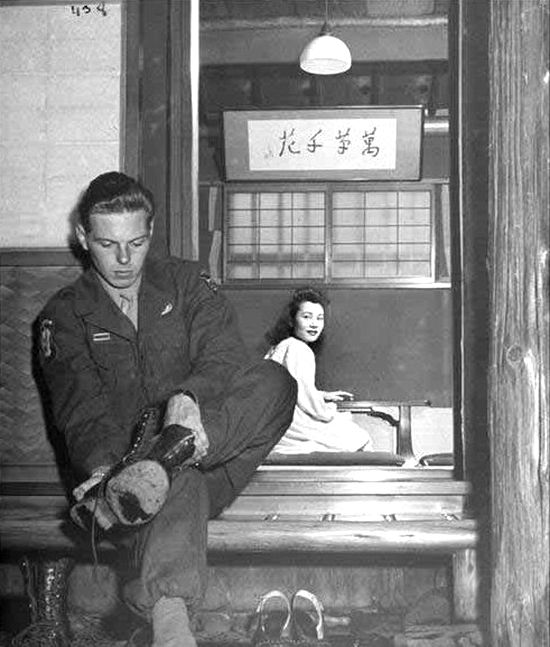











Das
Bild zeigt, wie eine große Anzahl sowjetischer Soldaten an die
Berliner Front vorrückt, bereit, die Schlacht um Berlin zu
beginnen. Auf einem Verkehrsschild steht: „165 km westlich von
Berlin, 1535 km östlich von Moskau“.

Das
Bild zeigt Marschall Schukow und hochrangige Offiziere der Ersten
Ukrainischen Front bei der Planung der Schlacht um Berlin anhand eines
Sandtisches.

Die
Sowjets konzentrierten 270 Infanterie- und Kavalleriedivisionen, 20
Panzerarmeen, 14 Luftflotten und 2,5 Millionen Soldaten in Belarus. Das
Bild zeigt Generaloberst Tschuikow, Marschall Schukow, Admiral Malinin
und Generaloberst Woronow (von links), wie sie den Angriffsplan
für die Schlacht um Berlin entwickeln.

Die
Rote Armee setzte 2450 Flugzeuge, 14.200 Geschütze und 1500 Panzer
ein. Ihnen gegenüber standen 48 deutsche Infanteriedivisionen,
neun motorisierte Divisionen, sechs Panzerdivisionen, etwa 800.000
Soldaten, 700 Geschütze und Mörser, 500 Panzer und 342
Kampfflugzeuge.

Die
Schlacht begann am 16. April 1945. Die sowjetischen Truppen
durchbrachen die Verteidigungslinien an Oder und Neiße und
umzingelten Berlin am 25. April. Das Bild zeigt Flakgeschütze, die
die Sicherheit der Transportwege gewährleisten sollen.

Während
der Straßenkämpfe stürmte die Rote Armee mehrgleisig
auf Berlin zu. Am 27. April drangen sowjetische Truppen in das
Stadtzentrum vor, am 29. April begann der Sturm auf das
Reichstagsgebäude. Am 30. April beging Hitler im Bunker
Selbstmord. Am 2. Mai kapitulierte die Berliner Garnison unter General
Weidling.

Am
9. Mai 1945 unterzeichneten deutsche Vertreter im Auftrag von Marschall
Keitel die bedingungslose Kapitulation in Berlin. Die Rote Armee setzte
während der Operation 48 Divisionen in Bewegung und erbeutete
große Mengen an militärischem Material. Das Bild zeigt den
Angriff der Roten Armee auf Berlins Vororte.

Der
Sieg der Roten Armee zerschlug das deutsche Oberkommando in Berlin und
markierte den endgültigen Zusammenbruch des Faschismus in Europa.
Das Bild zeigt eine schwere Artillerieeinheit in Berlin.

Am
Morgen des 16. April 1945 eröffneten Tausende sowjetische
Geschütze und „Katjuscha“-Raketen das Feuer auf
deutsche Stellungen. In der Morgendämmerung überquerten die
Armeen die Oder und die Neiße. Das Bild zeigt das Feuer der
sowjetischen Artillerie.

Über
Berlin kreisten sowjetische Bomberbesatzungen. Das Bild zeigt eine
sowjetische 2-2-Bomberformation über der Stadt.

Der
erste Angriff der belarussischen 1. Front scheiterte, auch wegen des
Nebels und deutschen Widerstands. Das Bild zeigt sowjetische Truppen am
Stadtrand Berlins.

Sümpfe
und starkes deutsches Feuer verzögerten den Vormarsch der Roten
Armee, die schwere Verluste erlitt. Schukow setzte daraufhin die
Reservearmeen ein. Bis zum Abend war ein Vorstoß von 6 km
gelungen.

Zhu
Kefus erste Armee in Belarus brach durch die deutsche erste
Verteidigungszone, der Tag kam mittags, dass die zweite
Verteidigungszone, aber wenn die Sowjetunion in die Verteidigungszone
Hub Zeluo Fu Heights, sondern war die deutsche Von dem Widerstand, die
Deutschen mit günstigem Gelände, hartnäckig bewachen
jeden Graben, jede Soldatengrube, da die sowjetische Armee ein
großer Mörder.

Am
17. April konzentrierte die sowjetische Armee ihre Kräfte erneut
und setzte fast tausend Panzer ein. Trotz hoher Verluste durch deutsche
Verteidiger gelang es schließlich, die Höhen von Seelow
einzunehmen.

Am
18. April begann der Vormarsch auf Berlin, nachdem die sowjetischen
Truppen die deutschen Verteidiger fast vollständig aufgerieben
hatten.

Am
20. April erreichten die ersten sowjetischen Truppen den Stadtrand
Berlins. Um 13:30 Uhr begann die erste Bombardierung Berlins durch
sowjetische Artillerie. Das Bild zeigt sowjetische Soldaten in der
Berliner U-Bahn.

Die
südlichen sowjetischen Truppen überquerten die Spree und
näherten sich von Süden her Berlin. Die 3. Panzerarmee
stieß in die südlichen Vororte vor.

Am
25. April 1945 schlossen sich sowjetische Truppen von Norden und
Süden westlich Berlins zusammen und schlossen damit den
Belagerungsring. Das Bild zeigt den Raketenabschuss von
„Katjuschas“.

An
diesem Punkt begann das deutsche Verteidigungssystem in der
Oder-Fluss-Fluss-Fluss durch die Sowjetunion Durchbruch, die
sowjetische Armee drei Tag und Nacht weiter vorwärts und weiter,
begann, um zu umarmen Berlin. Zu dieser Zeit war die sowjetische Armee
unter der Berliner Stadt, Hitler beschloß, sich aus dem deutschen
Berliner Kommandanten zurückzuziehen, er selbst ließ "und
Berliner Koexistenz".

Am 26. April
bombardierten Tausende sowjetische Flugzeuge erneut Berlin. Auf dem
Boden konzentrierten sich pro Kilometer etwa 1000 Geschütze.
Danach begann der Angriff auf das Stadtzentrum.
Die Sowjets
wendeten die in Stalingrad bewährte Taktik an: Zerstörung
durch Artillerie und Infanteriesturm durch Keller, U-Bahn-Schächte
und Hinterhöfe. Das Bild zeigt den Globus in Hitlers Büro.
Berlin war stark
befestigt, je näher am Zentrum, desto härter die Kämpfe.
Jeder Schritt kostete schwere Verluste. Das Bild zeigt eine große
Gruppe deutscher Kapitulierender.
Am 30. April um 15:30 Uhr begingen Hitler und Eva Braun Selbstmord im Führerbunker. Ihre Leichen wurden verbrannt.
Der Kampf um das
Reichstagsgebäude tobte erbittert. Am Abend des 30. April setzten
sowjetische Soldaten die Rote Fahne auf die Kuppel des Reichstags.
Am 1. Mai
kapitulierten die letzten deutschen Verteidiger in Berlin. Das Bild
zeigt deutsche Gefangene beim Durchmarsch durchs Brandenburger Tor.

Die
Schlacht um Berlin forderte einen hohen Tribut: 80.000 getötete
deutsche Soldaten, 480.000 Gefangene, zerstörte Panzer, Flugzeuge
und Geschütze. Die Sowjets erlitten rund 30.000 Verluste.
Drei Monate später kapitulierte Japan, der Zweite Weltkrieg endete.
Im Laufe der Einnahme Berlins wurden etwa 70 deutsche Divisionen
vernichtet, mehr als 48.000 deutsche Soldaten gefangen genommen. Das
Bild zeigt das Aufstellen eines Porträts Stalins auf der
Straße „Unter den Linden“.
Das Bild zeigt Beerdigungen gefallener sowjetischer Soldaten in Berlin.
Der 9. Mai wurde zum Tag des Sieges erklärt. Millionen
sowjetischer Soldaten wurden mit Medaillen ausgezeichnet, darunter
über eine Million mit der Medaille für die Eroberung Berlins.
Das Bild zeigt die Leichen deutscher Soldaten unter dem Brandenburger Tor.
Das ehemalige Reichstagsgebäude.
Deutsche bauten Barrikaden mit überschüssigen Panzertürmen zur Verteidigung gegen sowjetische Panzer.
„Katjuscha“-Raketenwerfer bereit zum Einsatz.

Vom
1945 bis zum 24. April stieß der linke Flügel der 1.
Belarussischen Front im Südosten Berlins mit der Ersten
Ukrainischen Front zusammen. Damit wurde die Verbindung zwischen der 9.
deutschen Armee und der Stadt Berlin abgeschnitten und die Einkesselung
der deutschen Truppen abgeschlossen.
Das Bild zeigt „Katyusha“-Raketenwerfer, die zum Abschuss bereitstehen.

Am
25. April 1945 schloss die Erste Belarussische Front im Norden den Ring
um die Berliner Truppen, während die Vierte Panzerarmee der Ersten
Ukrainischen Front im Westen Berlins auf sie traf. Damit war die
Einkesselung Berlins vollendet.
Das Bild zeigt „Katyusha“-Raketenwerfer.
Gleichzeitig wurde die deutsche Armee im Norden Berlins vom 2.
Belarussischen Frontabschnitt und dem rechten Flügel der 1.
Belarussischen Front angegriffen. Am selben Tag erreichte die der
Ersten Ukrainischen Front angeschlossene 5. Gardearmee die Elbe und
vereinigte sich bei den Höhen von Torgau mit der Westlinie der 1.
US-Armee.

Am
Morgen des 26. April 1945 bombardierten Tausende sowjetische Flugzeuge
erneut Berlin und warfen dabei tausende Tonnen Bomben und Brandbomben
ab. Am Boden konzentrierte sich pro Meile nahezu tausend Geschütze
unterschiedlichen Kalibers auf intensiven Beschuss.
Nach diesem Bombardement entsandte Schukows Erste Belarussische Front
unzählige Angriffsgruppen und Stoßtrupps, die aus allen
Richtungen in das Berliner Stadtgebiet vordrangen.
Die sowjetischen Truppen rückten bis zur Reichskanzlei vor.

Mit der Erfahrung von Stalingrad wussten die sowjetischen Soldaten genau, wie man eine Stadt erobert.
Zunächst bombardierten die Sowjets das Zielgebiet mit Artillerie
und Flugzeugen. Danach rückte die Infanterie, unterstützt von
Panzern, Flammenwerfern und Stoßtrupps, vor.
Die sowjetischen Einheiten durchdrangen Häuser vom Hinterhof,
durch Keller und sogar durch U-Bahn-Schächte und
Abwasserkanäle, um jede Straße und jedes Gebäude
systematisch einzunehmen.
Das Bild zeigt den Globus im Büro Hitlers.

Berlin
war eine massiv befestigte Stadt mit einem weitgehend intakten
Verteidigungssystem und äußerst starken Befestigungen.
Je näher die sowjetischen Truppen dem Stadtzentrum kamen, desto schwieriger wurde ihr Vormarsch.
Rauhe Gebäudestrukturen, versteckte Keller, U-Bahn-Schächte
und Entwässerungsgräben boten den Deutschen ideale Stellungen
für konzentrierte Feuerkraft.
Die Sowjets mussten Haus für Haus, Straße für
Straße kämpfen und für jeden kleinen Fortschritt einen
hohen Preis zahlen.
Das Bild zeigt eine große Anzahl deutscher Kapitulationen.

Zu diesem Zeitpunkt hing Hitler immer noch Illusionen nach.
Er sagte dem Kommandanten der Berliner Garnison, Helmuth Weidling:
„Die Situation wird sich verbessern. Unsere Neunte Armee wird
nach Berlin kommen, gemeinsam mit der Zwölften Armee angreifen und
die Russen in Berlin katastrophal schlagen.“
Helmuth Weidling, Kommandant der Berliner Garnison und des
Hauptquartiers der Verteidigungstruppen, führte schließlich
seine Truppen am 2. Mai der sowjetischen Seite unter Marschall Georgi
Schukow zur Kapitulation.

Am 27. April 1945 hatte die sowjetische Armee den 9. Bezirk von Berlin erreicht.
Keitel wurde nach Berlin gerufen und erhielt ein Telegramm, das die bittere Wahrheit bestätigte:
Die Zwölfte Armee konnte sich nicht weiter nach Berlin
vorarbeiten, und die Neunte Armee war nicht in der Lage, den Kessel zu
durchbrechen.
Damit war Hitlers letzte Hoffnung endgültig zerstört.
Das Bild zeigt eine Sanitätsstation der Roten Armee, die auf einer Berliner Straße Verwundete versorgt.

Der
Berliner Garnisonskommandant Helmuth Weidling bat Hitler um Erlaubnis,
mit den Verteidigern der Hauptstadt auszubrechen, um „die
Führung des Staates sicher aus Berlin zu evakuieren“.
Er berichtete außerdem, dass die Munition nur noch für zwei
Tage und Nächte reiche und dass Nahrung und Medizin fast
vollständig aufgebraucht seien.
General der Infanterie Hans Krebs, Chef des Generalstabs des Heeres,
empfahl Weidling aus militärischer Sicht ebenfalls den
Ausbruchsversuch, da dieser Plan noch realisierbar erschien.
Das Bild zeigt sowjetische Soldaten, die sich vor dem Reichstagsgebäude fotografieren lassen.

Hitler
erkannte jedoch, dass er diesen Krieg vollständig verloren hatte,
den er selbst entfesselt hatte, weigerte sich aber, Berlin zu verlassen.
Am 28. April 1945 drangen die 3. Stoßarmee der Garde und Teile
der 8. Garde-Armee der 1. Belarussischen Front in den Berliner
Stadtteil Tiergarten vor.
Das Bild zeigt sowjetische Truppen im Inneren der Stadt.
Generaloberst Wassili
Tschuikow befahl der 8. Garde-Armee am frühen Nachmittag, den
Landwehrkanal zu überqueren und den von den Deutschen
kontrollierten Kommunikationsknotenpunkt zu erobern, wodurch die
wichtigste Verbindung Berlins zur Außenwelt abgeschnitten wurde.
Spät in der Nacht stürmte die 3. Stoßarmee unter dem
Kommando von Generaloberst Wassili Kusnezow von außen die
Bastionen und drang bis zum Gebäude des Innenministeriums am
Königsplatz vor.

Die
verzweifelten deutschen Truppen leisteten weiterhin erbitterten
Widerstand, doch die meisten von ihnen wurden bis spät in die
Nacht des 29. April getötet. Erst nach schweren Verlusten gelang
es der sowjetischen Armee, das Gebäude einzunehmen.
Um 1:00 Uhr am 29. April verkündete Hitler, der 12 Jahre lang auf
diesen Moment gewartet hatte, seine Hochzeit mit Eva Braun.
Nach der Zeremonie diktierte Hitler sein politisches Testament und
bestimmte Großadmiral Karl Dönitz zu seinem Nachfolger.

Hitler
beschloss, Selbstmord zu begehen und verfügte, dass seine
Überreste im Garten der Reichskanzlei verbrannt werden sollten.
Am 30. April um 15:30 Uhr, einen Tag nach seiner Hochzeit, begingen
Hitler und seine Frau Eva Braun gemeinsam Selbstmord im Schlafzimmer
des unterirdischen Bunkers: Eva Braun nahm Gift, während Hitler
sich zusätzlich eine Pistole an die Schläfe hielt und
abdrückte.
Anschließend trug Joseph Goebbels die Leichen von Hitler und Eva
Braun in den Garten der Reichskanzlei, übergoss sie mit Benzin und
ließ sie verbrennen.

Die Kämpfe der Roten Armee um das Reichstagsgebäude dauerten weiterhin an.
Die 150. Infanteriedivision der 3. Stoßarmee stand den Truppen im Capitol am nächsten und setzte den Angriff fort.
Am Nachmittag des 30. April 1945, um 18:30 Uhr, startete die Rote Armee
einen erneuten Sturm auf das Capitol. Rund 2000 deutsche Soldaten
verteidigten das Gebäude erbittert und kämpften um jeden
Quadratmeter und jede Ecke.
Trotz dieses erbitterten Widerstands gelang es der Roten Armee durch
unaufhörliche Angriffe allmählich, den deutschen Widerstand
zu brechen und das Gebäude zu erobern.

In
der Schlacht, obwohl die Rote Armee die unteren Stockwerke des
Gebäudes eingenommen hatte, weigerten sich die deutschen
Verteidiger in den oberen Etagen weiterhin, sich zu ergeben.
Etage für Etage kämpfte die Rote Armee erbittert gegen die Deutschen.
Um 21:50 Uhr hissten der Held der Sowjetunion, Sergeant Michail
Tschantarija, und der Unteroffizier Meliton Kantaria die sowjetische
Rote Fahne auf der Kuppel des Hauptgebäudes des Reichstags.
Das Bild zeigt Marschall Schukow, wie er die Straßen Berlins inspiziert.

Gegen
Mitternacht am 30. April übermittelten die Deutschen eine Anfrage
für einen vorübergehenden Waffenstillstand und Verhandlungen
mit der Roten Armee.
Um 3:55 Uhr am 1. Mai erschien der deutsche Generalstabschef der
Luftwaffe, General Hans Krebs, unter einer weißen Fahne im Amt
des Reiches, um im Namen der deutschen Führung mit der 8.
Gardearmee der Sowjets über die Kapitulation zu verhandeln.
Das Bild zeigt deutsche Gefangene, die durch das Brandenburger Tor marschieren.

In den Straßen von Berlin operierte eine angeschlossene sowjetische Panzergruppe.

April 1945 Berliner Straße.

In
der Schlacht um Berlin vernichtete die sowjetische Armee 800.000
deutsche Soldaten, nahm über 480.000 Gefangene, zerstörte und
erbeutete mehr als 100 Panzer und Selbstfahrlafetten, vernichtete und
erbeutete über 600 Flugzeuge sowie zahlreiche
Artilleriegeschütze. Die Sowjetunion zahlte dafür einen hohen
Preis: etwa 300.000 Tote.

Drei
Monate später, mit der Kapitulation Japans, endete der Zweite
Weltkrieg schließlich mit dem vollständigen Sieg der
Alliierten. Das Bild zeigt Hans Klein, der zu den Verhandlungen mit der
sowjetischen Führung in das Hauptquartier der deutschen Kammer
kam, wo Marschall Schukow die bedingungslose Kapitulation Deutschlands
forderte.

Bei
der Einnahme Berlins vernichtete die sowjetische Armee insgesamt 70
deutsche Infanteriedivisionen sowie 23 Panzer- und motorisierte
Divisionen. Mehr als 100.000 deutsche Soldaten wurden gefangen
genommen, darunter 48.000 Offiziere. Fast jeder zweite deutsche Soldat
geriet in sowjetische Gefangenschaft.
Das Bild zeigt die Straße „Unter den Linden“,
über der ein großes Porträt Stalins aufgehängt
wurde.

Das
Bild zeigt Soldaten der Roten Armee, die ihren im letzten Moment der
Schlacht um Berlin gefallenen Kameraden ein Begräbnis bereiten.

Der
9. Mai wird jedes Jahr als Tag des Sieges gefeiert. Zum Gedenken an
dieses historische Ereignis verlieh das höchste sowjetische
Gremium die Medaille „Sieg über Deutschland im Großen
Vaterländischen Krieg 1941–1945“, die an mehr als 13,5
Millionen sowjetische Soldaten vergeben wurde. Es gab auch die Medaille
„Einnahme von Berlin“. Etwa 1.082.000 Soldaten erhielten
diese Auszeichnung.
Das Foto zeigt die Leiche eines deutschen Soldaten unter dem Brandenburger Tor.

Der ehemalige deutsche Reichstag.

Deutsche
errichteten eine Barrikade aus überschüssigem Material, um
sich gegen die Panzer der Sowjetunion zu verteidigen.

Die sowjetischen Raketenwerfer vom Typ Katjuscha sind zum Feuern bereit.