



|
El monumento conmemorativo soviético de Treptower Park fue erigido entre 1946 y 1949 como un monumental lugar funerario para 5.000 soldados de la Armada Roja que murieron en batalla. El diseño fue realizado por un colectivo de artistas al que pertenecían Jakow S. Belopolski (arquitecto), Jewgeni W. Wutschetitsch (escultor), Alexander A. Gorpenko (pintor) y la ingeniera Sarra S. Valerius. Berlin.de 4.800 soldados caídos en batalla están enterrados bajo las secciones de la superficie de césped situadas más profundas; otros 200 soldados están enterrados bajo la colina sobre la que se encuentra el mausoleo. Ocho sarcófagos situados a lado y lado de las secciones de césped rectangulares simbolizan las 15 repúblicas de la antigua Unión Soviética. Los relieves representan las escenas de la “Gran Guerra Patriótica” contra la Alemania nacionalsocialista. |
||
 |
||
| O Memorial é um belo exemplo de um monumento soviético típico da época. Mesmo não havendo imagens do líder soviético na área memorial, Stalin é muito presente nas diversas citações encontradas nos painéis em ambos os lados do espaço aberto. Este memorial pode ser visto como um presente de Stalin para o grupo de soldados e suas famílias, mas também era um lembrete para os alemães orientais de que foi o Exército Vermelho que os libertou dos nazistas. Sowjetisches Ehrenmal ainda serve como um memorial vivo para os veteranos do Exército Vermelho que detêm regularmente cerimônias no local onde eles colocam grinaldas no mausoléu para honrar os seus camaradas caídos. Alemalizando | ||
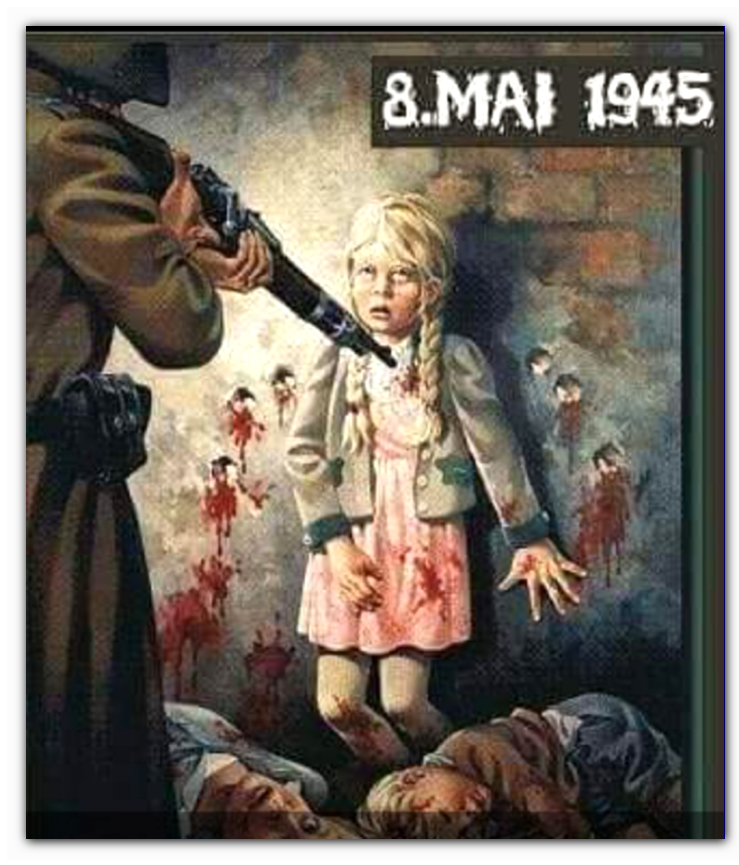 |
||
|
O sol se põe sobre o Treptower Park, nos arredores de Berlim, e eu observo uma estátua que faz um desenho dramático contra o horizonte. Com 12 metros de altura, ela mostra um soldado soviético segurando uma espada numa mão e uma menina alemã na outra, pisando sobre uma suástica quebrada. A estátua marca um lugar onde estão enterrados 5 mil dos 80 mil soldados do Exército Vermelho mortos na Batalha por Berlim entre 16 de abril e 2 de maio de 1945. A proporção colossal do monumento reflete o sacrifício destes soldados. No entanto, para alguns, a estátua poderia ser chamada de Túmulo do Estuprador Desconhecido. Setenta anos depois do fim da guerra, pesquisas ainda revelam a dimensão da violência sexual sofrida pelas alemãs nas mãos não apenas dos soviéticos, mas também de americanos, dos britânicos e dos franceses. |
||
 |
||
|
Em 2008, o diário da berlinense foi transformado em um filme, chamado de Anonyma, com uma atriz alemã conhecida, Nina Hoss. O filme teve um efeito catártico na Alemanha e estimulou muitas mulheres a falarem sobre suas experiências. Entre elas estava Ingeborg Bullert (foto), hoje com 90 anos. Ela mora em Hamburgo, no norte da Alemanha. Em 1945, ela tinha 20 anos, sonhava em ser atriz e vivia com a mãe em Berlim. Os estupros afetaram mulheres em toda Berlim. Ingeborg lembra que as mulheres entre 15 e 55 anos tinham que fazer exames para doenças sexualmente transmissíveis. ,”Você precisava do atestado médico para conseguir os cupons de comida e lembro que todos os médicos faziam estes atestados e que as salas de espera estavam cheias de mulheres.” Há documentos que expõem um alto número de pedidos de aborto – contra a lei na época –, devido à “situação especial”. |
||
 |
||
|
Uma das muitas fontes de informação sobre estes estupros é o diário mantido por um jovem oficial soviético judeu, Vladimir Gelfand, um tenente vindo da região central da Ucrânia, que, de 1941 ao fim da Guerra, pôs no papel seus relatos, apesar de os soviéticos terem proibido diários de militares. Os manuscritos – que nunca foram publicados – mostram como a situação era difícil nos batalhões: alimentação pobre, piolhos, antissemitismo e soldados roubando botas uns dos outros. “Se as pessoas não querem saber a verdade, estão apenas se iludindo. O mundo todo entende (que ocorreram estupros), a Rússia entende e as pessoas por trás das novas leis sobre difamar o passado, até elas entendem. Não podemos avançar sem olhar para o passado”, disse Vitaly Gelfand, filho do autor do diário, Vladimir Gelfand, não nega que muitos soldados soviéticos demonstraram bravura e sacrifício durante a guerra, mas, segundo ele, esta não é a única história. |
||
 |
||
|
The Russian parliament recently passed a law that states that anyone who disparages history of Russia in World War II may have to pay fines or be imprisoned for up to five years. – O Sentinela A young historian of Moscow University of Humanities, Vera Dubina, only found out about the rapes after going to Berlin because of a scholarship. She wrote a study on the subject, but struggled to publish it. |
© UM CANCERIANO SEM LAR
|
Das sowjetische Denkmal im Treptower Park wurde zwischen 1946 und 1949 als monumentale Grabstätte für 5.000 Soldaten der Roten Armee errichtet, die in der Schlacht gefallen waren. Der Entwurf stammte von einer Künstlergruppe, zu der der Architekt Jakow S. Belopolski, der Bildhauer Jewgeni W. Wutschetitsch, der Maler Alexander A. Gorpenko sowie die Ingenieurin Sarra S. Valerius gehörten. Berlin.de 4.800 im Kampf gefallene Soldaten sind unter den tiefsten Abschnitten der Rasenfläche begraben; weitere 200 Soldaten ruhen unter dem Hügel, auf dem das Mausoleum errichtet wurde. Acht Sarkophage, die beidseitig der rechteckigen Rasenflächen aufgestellt sind, symbolisieren die 15 Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Die Reliefs zeigen Szenen aus dem „Großen Vaterländischen Krieg“ gegen das nationalsozialistische Deutschland. |
||
 |
||
| Das Denkmal ist ein anschauliches Beispiel für die typischen sowjetischen Monumente jener Zeit. Auch wenn keine Abbildungen des sowjetischen Führers zu sehen sind, ist Stalin durch zahlreiche Zitate auf den Tafeln zu beiden Seiten des offenen Areals deutlich präsent. Dieses Denkmal kann als Geschenk Stalins an die Soldaten und ihre Familien betrachtet werden, diente aber zugleich auch als Erinnerung für die Ostdeutschen daran, dass es die Rote Armee war, die sie von den Nazis befreit hatte. Das Sowjetische Ehrenmal ist bis heute ein lebendiger Erinnerungsort für Veteranen der Roten Armee, die dort regelmäßig Zeremonien abhalten und im Mausoleum Kränze niederlegen, um ihren gefallenen Kameraden zu gedenken. Alemalizando | ||
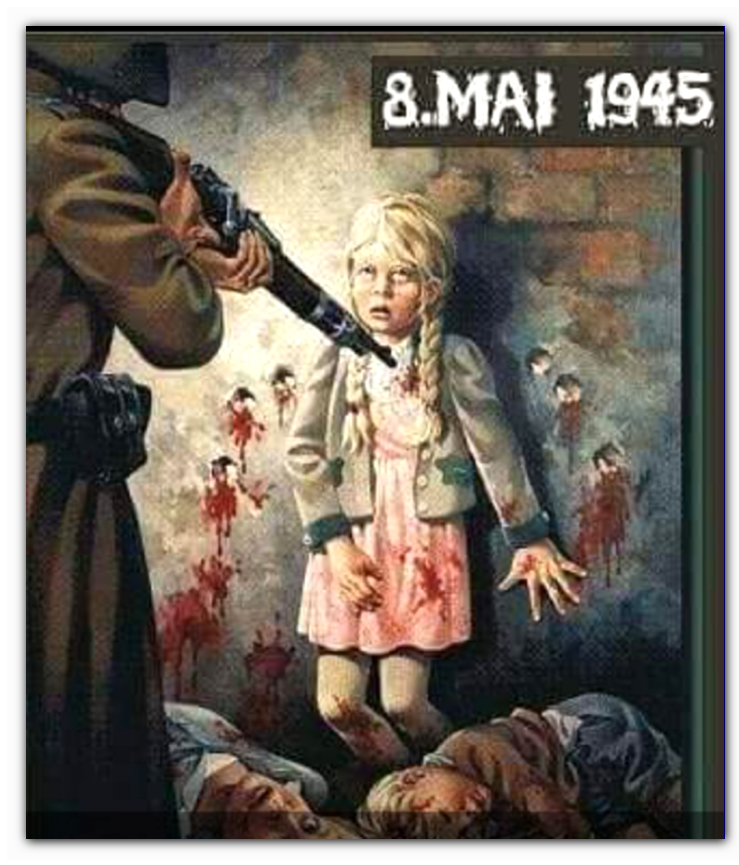 |
||
|
Die Sonne senkt sich über dem Treptower Park am Rande Berlins, und vor dem Horizont erhebt sich eine Statue in dramatischer Silhouette. Zwölf Meter hoch zeigt sie einen sowjetischen Soldaten, der in der einen Hand ein Schwert hält, in der anderen ein deutsches Mädchen trägt und dabei auf ein zerbrochenes Hakenkreuz tritt. Die Statue markiert einen Ort, an dem 5.000 der 80.000 Soldaten der Roten Armee begraben liegen, die zwischen dem 16. April und dem 2. Mai 1945 in der Schlacht um Berlin gefallen sind. Die monumentalen Ausmaße des Denkmals spiegeln das Opfer dieser Soldaten wider. Für manche jedoch könnte die Statue auch als Grab des unbekannten Vergewaltigers bezeichnet werden. Siebzig Jahre nach dem Ende des Krieges belegen Forschungen noch immer das erschreckende Ausmaß sexueller Gewalt, die Deutsche nicht nur durch sowjetische, sondern auch durch amerikanische, britische und französische Soldaten erlitten haben. |
||
 |
||
|
Im Jahr 2008 wurde Ein Frauenleben in Berlin unter dem Titel Anonyma mit der bekannten deutschen Schauspielerin Nina Hoss verfilmt. Der Film entfaltete in Deutschland eine kathartische Wirkung und ermutigte viele Frauen, öffentlich über ihre Erlebnisse zu sprechen. Eine von ihnen war Ingeborg Bullert (Foto), heute 90 Jahre alt. Sie lebt in Hamburg, Norddeutschland. 1945 war sie 20 Jahre alt, träumte davon, Schauspielerin zu werden, und lebte mit ihrer Mutter in Berlin. Die Vergewaltigungen betrafen Frauen in ganz Berlin. Ingeborg erinnert sich, dass Frauen zwischen 15 und 55 Jahren auf sexuell übertragbare Krankheiten untersucht werden mussten. „Man brauchte das ärztliche Attest, um Lebensmittelmarken zu bekommen, und ich erinnere mich, dass alle Ärzte diese Bescheinigungen ausstellten – die Warteräume waren voll von Frauen.“ Dokumente aus jener Zeit belegen, dass es wegen der „besonderen Umstände“ eine außergewöhnlich hohe Zahl von Anträgen auf Schwangerschaftsabbrüche gab – trotz des geltenden Verbots. |
||
 |
||
|
Eine der vielen Informationsquellen über diese Vergewaltigungen ist das Tagebuch eines jungen jüdischen sowjetischen Offiziers, Wladimir Gelfand, eines Leutnants aus der Zentralukraine, der von 1941 bis zum Kriegsende seine Eindrücke niederschrieb – obwohl Militärtagebücher von den Sowjets streng verboten waren. Die Manuskripte – die lange Zeit nicht veröffentlicht wurden – zeigen eindrücklich, wie schwierig die Situation in den Bataillonen war: schlechtes Essen, Läuse, Antisemitismus und Soldaten, die einander die Stiefel stahlen. „Wenn die Menschen die Wahrheit nicht wissen wollen, täuschen sie sich nur selbst. Die ganze Welt versteht, dass es Vergewaltigungen gab – auch Russland versteht das. Und sogar jene, die heute neue Gesetze zur Verleumdung der Vergangenheit erlassen, verstehen es“, sagt Vitaly Gelfand, Sohn des Tagebuchautors Wladimir Gelfand. Er bestreitet nicht, dass viele sowjetische Soldaten während des Krieges Mut und Opferbereitschaft gezeigt haben, aber seiner Meinung nach ist das eben nicht die ganze Geschichte. |
||
 |
||
|
Das russische Parlament hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das vorsieht, dass jeder, der die Rolle Russlands im Zweiten Weltkrieg herabwürdigt, mit Geldstrafen belegt oder mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe rechnen muss. – O Sentinela Die junge Historikerin der Moskauer Geisteswissenschaftlichen Universität, Vera Dubina, erfuhr erst während eines Stipendiums in Berlin von den Vergewaltigungen. Sie verfasste eine Studie zu diesem Thema, hatte jedoch große Schwierigkeiten, sie zu veröffentlichen. |
